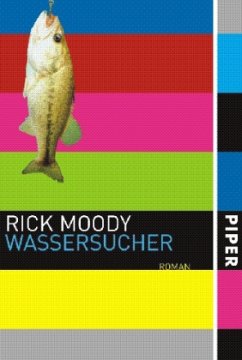Rick Moodys gefeierter neuer Roman ist ein unwiderstehliches Meisterwerk voller Witz, sprachlicher Finesse, Rasanz und kluger Beobachtung: »Erschütternd in seiner Komik und eindringlich in seiner tiefen Ernsthaftigkeit ist ›Wassersucher‹ Moodys ehrgeizigster und bester Roman. Unter dem messerscharfen Humor wohnt eine zarte Verzweiflung des Künstlers an einer Welt, die unbewohnbar und unmöglich zu lieben geworden ist«, schreibt die amerikanische Kritik über »Wassersucher«. Fulminant erzählt Rick Moody darin von der Jagd nach dem heiß begehrten Stoff für eine alles umspannende Fernsehsaga, einem Stoff, der unseren Durst nach Glück und Liebe stillen wird. Bevölkert von einer unvergeßlichen Galerie ebenso unterschiedlicher wie eindrücklicher Charaktere, ist es die große amerikanische Komödie von Ehrgeiz, Einsamkeit und dem Aberwitz unserer Mediengesellschaft.

Feuerwehr im Purgatorium: Rick Moody beschreibt die Medienwelt der Jahrtausendwende als Irrenhaus
Jede große Literaturnation hat ihr eigenes Kreuz zu tragen. Als in Deutschland der endgültige Roman über Wende und Mauerfall postuliert wurde, war klar, daß sich die Zeitgeschichte in einem zünftigen Bildungs-, Antibildungs-, Schelmen- oder Antischelmenroman niederzuschlagen habe, mit reichlich Goethe- und Thomas-Mann-Anspielungen, was Ingo Schulze dann im vergangenen Jahr mit seinen "Neue Leben" einlöste. In den Vereinigten Staaten ist die great american novel die Latte, die jeder zünftige Romancier zu überspringen hat - das umfassende psychologisch-realistische Gesellschaftspanorama mit zeitdiagnostischer Fieberkurve, aktuellem politischem Bezug, exemplarischem Plot und sozialkritischem Rundumschlag, kurz: der Pauschalroman mit Vollpension, Erzählen all inclusive.
Der neue Roman von Rick Moody, geboren 1961, setzt mit einem Prolog ein, der "Vorspann und Titelmusik" überschrieben ist und in Satellitenperspektive einmal mit dem aufgehenden Sonnenlicht die Welt umkreist, angefangen in Los Angeles und endend in New York, wo die Handlung des Romans hauptsächlich stattfindet. Und der hier beschriebene Tag ist nicht irgendeiner, sondern der Tag nach der amerikanischen Präsidentenwahl im Jahr 2000 (jener am Ende von Bush gewonnenen Wahl, um deren Stimmzettel es noch ein juristisches Nachspiel gab). So weiß man gleich, was hier gespielt wird: nämlich die ganz große Orgel.
Auf die Filmbranche übertragen heißt das: Cinemascope. Im Zentrum der Handlung steht eine kleine, unabhängige, in Studentenkreisen legendäre Filmproduktionsfirma in Manhattan, deren Chefin, eine freßsüchtige, zwangsneurotische Italoamerikanerin namens Vanessa Meandro, versucht, mit einem epischen Mehrteiler ins lukrativere Fernsehgeschäft einzusteigen. Das überdimensionierte Projekt, zunächst buchstäblich die Schnapsidee eines hochstapelnden Mitarbeiters, soll über viele Jahrhunderte und mehrere Erdteile hinweg die geheime Geschichte einer Sippe von Wünschelrutengängern, den "Wassersuchern" eben, verfolgen und so die gesamte Geschichte der Menschheit zum quotentauglichen Mythos zusammenkochen. Für das Poster schlägt das Marketing vor: "Liebe, Hunger, Krieg, Durst, halbnackte Männer, ethnische Säuberungen, die Erschaffung von Las Vegas . . . so in der Art".
Um diesen hysterisch zappelnden Medien-Mikrokosmos herum entwirft Moody ein satirisches Panorama zeitgenossischer Physiognomien: das oberflächliche Agentur-Girl und fashion victim wie aus einem Bret-Easton-Ellis-Roman; der nach Höherem strebende Actionfilmheld und Feierabend-Don Juan, der meditiert und heimlich schreibt; der vom Konkurrenzdruck aufgefressene Familienvater, der als letzte Karrierechance zugekokste Popsternchen hofieren muß; die von Schönheitschirurgie besessene Erfolgsschriftstellerin - alle Figuren sind lodernder Scheite im Fegefeuer der Eitelkeiten, als das Moody die aufgekratzte Medienwelt der Jahrtausendwende karikiert. "The Bonfire of the Vanities" von Tom Wolfe steht nicht nur beim Namen der Chefin Vanessa Pate. Klar, daß die (mit Pro- und Epilog) genau dreiunddreißig Kapitel des Buches der Zahl der Gesänge von Dantes "Inferno" beziehungsweise "Purgatorio" entsprechen.
Moody hat in seinen früheren Büchern, vor allem in dem mit großem Erfolg von Ang Lee verfilmten Roman "Der Eissturm" (1994) bewiesen, daß er ein genauer und schonungsloser Porträtist menschlicher Abgründe und Illusionen ist und es grandios versteht, Innen- und Außenwelt ineinander zu spiegeln - insofern enthielten seine Psychogramme immer schon eine moralisierende Gesellschaftskritik. In seinem letzten Roman "Ein amerikanisches Wochenende" wurden solche Analogien aber bereits gefährlich überstrapaziert, indem Moody den alten, kranken Körper einer Frau mit einem Störfall im nahegelegenen Atomkraftwerk überblendete. Vielleicht hat das Scheitern dieses sehr ambitionierten Romans dem Autor diese lange Pause abverlangt.
Nun hat sich Moody mit "Wassersucher" als Erzähler noch einmal neu erfunden; doch die Gesellschaftssatire, die den Stier erstmals direkt bei den Hörnern, nämlich dem kulturindustriellen Komplex packt, mißlingt dennoch. Das hat mehrere Gründe: Zunächst hat Moody seine Geschichte historisch so genau verankert, daß sie nun schon anachronistisch erscheint. Sie spielt vor dem 11. September, die Zwillingstürme überragen Manhattan noch; zugleich ist die Bush-Ära schon angebrochen. Einerseits schillert Moody die New-Economy-Seifenblase in aller Farbenpracht; andererseits werden Internet-Suchmaschinen noch wie etwas Wundersames betrachtet. Vielleicht ist es schon aus Gründen der Beschleunigung objektiv unmöglich geworden, einen absolut gegenwärtigen Zeitroman zu schreiben Das ist aber ganz sicher so, wenn man den Plot an die kurzatmigen Trends der Medien koppelt.
Hinzu kommen inhaltliche Ungereimtheiten: Welcher Teufel sollte eine für experimentelle Künstlerdokus bekannte Firma reiten, einen solchen Ethno-Schund zu produzieren? So erscheint die ganze Film- und Fernsehbranche, einschließlich ihrer fortschrittlichen Teile, als geschmacksverkalktes Kunstgewerbe. Für wahre Künstler, wie den in der Nebenhandlung als Fahrradkurier arbeitenden Maler, scheint es in dieser verkehrten Welt keinen Platz zu geben - außer in der Literatur.
Und das ist des Pudels Kern: "Wassersucher" ist die auf unangenehme Weise selbstgefällige Demonstration der Überlegenheit des Mediums "Roman" über den Film. Dieser zeitgenössische Wettstreit der Künste wird allerdings mit ungleichen Waffen ausgetragen: Indem Moody jedes Kapitel seiner wie am Reißbrett entworfenen Geschichte anders erzählen läßt - etwa aus der Sicht eines lernbehinderten Kindes, einer Alkoholikerin im Delirium oder im Stil einer linguistischen Studie -, wirkt der Roman bei aller Virtuosität im Detail wie ein Musterbuch für Creative Writing, gegen das die konventionelle Filmerzählung mit Sex und Crime und Wüstensand zwangsläufig konventionell erscheint.
Während die Filmleute nur die Verwertungskette der reißerischen Story interessiert, wird die "Wassersuche" im Roman zur umfassenden Metapher für einen metaphysischen Durst, an dem alle Menschen leiden. Fast alle Figuren sind von irgendetwas abhängig - von Schokolade, Drogen, Alkohol, Klamotten, Ruhm, Macht oder Sex; am Ende aber suchen alle doch nur Liebe und den Sinn des Lebens. Die für die Satire notwendige Distanz zum Gegenstand erkauft sich Moody durch eine intellektuelle Überheblichkeit, die gegen die grelle Oberflächlichkeit der Medienwelt die Tiefe der Literatur setzt. Das wahre Heil liegt im Erzählen; der Literat ist der fire fighter in den Höllenflammen der Kulturindustrie. Doch wenn wir schon bei Abhängigkeiten sind - es gibt auch eine schriftstellerische Großmannssucht.
Rick Moody: "Wassersucher". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Ingo Herzke. Piper Verlag, München 2006. 604 S., geb., 23,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Den Rezensenten Michael Schmitt verleitet die Lektüre von Rick Moodys "Wassersucher" zu begeisterten Luftsprüngen. Zu seinem Thema - die gefälligen Selbsterklärungsmythen der Gegenwart - habe der Autor ein geradezu "kongeniales" Format gewählt: die Fernsehserie. So gelinge es Moody, in den 31 Kapiteln, die seine Geschichte um eine kleine Filmproduktionsfirma und deren Mehrteiler-Projekt "Wassersucher" umfasst, ganz New York einzufangen. Moodys Erzählung lebe von ihrer serienartigen "Sprunghaftigkeit", ihrem stets präsenten und dennoch lax gesponnenen roten Faden, um den sich zahlreiche dramaturgische Nebenschauplätze ranken. Sie kommt daher als eine mit zahllosen "kleinen Dramen" gesättigte Satire, die den großen Zusammenhang der Schicksale sucht. Der dabei lauernden Gefahr der moralischen Keule, so das Fazit des Rezensenten, geht Moody leichthändig aus dem Weg, indem er seine Figuren zwar gnadenlos ins Klischeehafte reißt, sie aber nicht darin aufgehen lässt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH