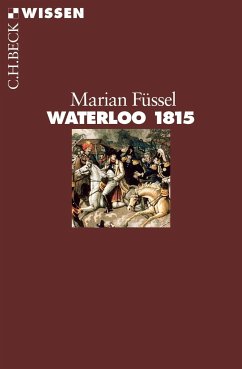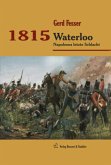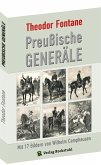Am 18. Juni 1815 wurde die Schlacht bei Waterloo (oder La Belle-Alliance) geschlagen. Dort beendeten Wellington, Blücher und Gneisenau mit ihren englischen und preußischen Truppen die Herrschaft der Hundert Tage, die Napoleon I., aus dem Exil zurückgekehrt, noch einmal hatte errichten können. Marian Füssel erläutert die historischen Voraussetzungen der Schlacht, beschreibt den Weg Napoleons nach Waterloo, erzählt den Verlauf der Kämpfe, resümiert das Nachleben und erhellt die Entstehung des "Mythos Waterloo".
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno