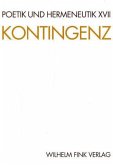Produktdetails
- Verlag: Brill Fink / Wilhelm Fink Verlag
- Artikelnr. des Verlages: 1882336
- 1994.
- Seitenzahl: 435
- Deutsch
- Abmessung: 215mm
- Gewicht: 525g
- ISBN-13: 9783770529827
- ISBN-10: 3770529820
- Artikelnr.: 05529998
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Hans Robert Jauß versteht alles Von Friedmar Apel
Hans-Georg Gadamer, der Heidelberger Virtuose der Lehre vom Verstehen, erzählte gern den Mythos von der Entstehung des Professors: Entgegen der Schrift habe Gott am siebten Tage keineswegs geruht, sondern das erhabenste aller Wesen geschaffen: den deutschen Ordinarius. Dessen Anblick nun habe seinerseits Satan nicht ruhen lassen, bis er das scheußlichste aller Geschöpfe zustande brachte: den Herrn Kollegen.
So war es bei den Begründern der modernen literarischen Hermeneutik und der Geisteswissenschaften, da diese ja ihren Anteil in der romantischen Rekonstruktion des Paradieses haben sollten, nicht geplant gewesen. Herder, Friedrich Schlegel und Schleiermacher hatten das Verstehen und die "Kunstlehre" davon als eine umfassende Strategie der Identifikation konzipiert. Durch das Verstehen geistiger Objektivationen und das Verstehen des Verstehens sollte das Subjekt seinen reflektierten Anteil am Werden von Sprache, Kunst, Geschichte und Gesellschaft erhalten und allen Ausdruck als Willen des Subjekts erfahren. In diesem Prozeß sollte Einheit als Vielheit gedacht werden, am Ende stand die Idee eines neuen Paradieses, einer Gesellschaft und eines Staates, in der das Besondere im Allgemeinen sich geborgen fühlen sollte, ohne seine Eigenheit aufgeben zu müssen. Die geisteswissenschaftlichen Kollegien hätten ein Modell dieser friedlichen Koexistenz abgeben sollen, und so konnte Friedrich Schlegel vor seiner Jenaer Antrittsvorlesung von einer "Symphonie der Professoren" träumen. Zu einer solchen spannungsreichen Freiheit kam es dauerhaft, wie man weiß, weder in Staat und Gesellschaft noch in der Wissenschaft.
Bald sollte sich Nietzsche die Auslöschung Wilamowitz-Moellendorffs wünschen, der wiederum erhielt von Theodor Mommsen Strategieunterricht im Wissenschaftskrieg. Das berühmte Duellvorhaben des Germanisten Wilhelm Scherer erscheint dagegen wie eine rührende Erinnerung an die imaginäre Ritterlichkeit der frühromantischen Utopien. Die weitere Entwicklung bis hin zur Rolle der Philologen in der Nazizeit, die freilich keineswegs in der Kontinuität mit der Frühromantik gesehen werden kann, ist inzwischen wohlbekannt. In jedem Fall ist der Verdacht historisch begründet, daß auch das reflektierte Verstehen nicht vor Feindschaft und Barbarei schützt. Unbeirrt davon (oder in Absehung, denn der Holocaust wird bei Hans Robert Jauß als das absolut nicht zu Verstehende bezeichnet) legt nun das Haupt der Konstanzer Schule der Literaturwissenschaft und der Forschungsgruppe "Poetik und Hermeneutik" eine Schrift zum ewigen Frieden im Geiste Kants und Schleiermachers vor. Den Gebildeten unter den Verächtern der literarischen Hermeneutik ("von Jacques Derrida, Paul de Man, Michael Foucault bis zu François Lyotard" nebst Adepten) soll deren Unentbehrlichkeit demonstriert werden.
Ist die Hermeneutik "doch von Haus aus dialogisch und grenzüberschreitend zugleich, sofern es ihr darum geht, nicht nur eine Sache, sondern auch das Eigene im Fremden und damit den anderen im Horizont seiner eigenen Welt zu verstehen". Und so sieht man alsbald, daß sich Jauß' Aufsätze und Vorträge der letzten Jahre wie von selbst zur hermeneutischen Programmschrift der postideologischen Epoche ordnen. Dieses Programm wird ohne Eifer, mit der Gelassenheit eines Emeritus präsentiert, der über das Gerede von der Krise der Hermeneutik hinweg recht behalten hat. Wie die Demokratie, so hat sich für den 1921 geborenen Jauß auch die Hermeneutik als die anpassungsfähigste Verfahrensweise erwiesen. "Verstehen, nach Heidegger eine Grundbestimmung des menschlichen Daseins, hat sein Vermögen im Horizontwandel geschichtlicher Erfahrung allmählich entfaltet und dabei immer wieder andere Möglichkeiten zwischenmenschlicher Kommunikation ergriffen, erprobt, normiert und institutionalisiert." Wer sich so ruhig und über die Brüche hinweg in der Kontinuität geschichtlicher Erfahrung sieht, braucht natürlich niemanden zu beschimpfen oder zu verteufeln.
Der Titel "Wege des Verstehens" bedarf nach Jauß keiner ausführlichen Erläuterung; ihm liegt die Auffassung zugrunde, daß Verstehen "nicht auf einem einzigen, für alle verbindlichen Weg gesucht werden muß, sondern auf verschiedenen Wegen erreicht werden kann". Das ist auf eine so tiefgründige Weise allgemein und ausgetreten, daß man doch ins Grübeln kommt, und dabei stellt sich die Erinnerung an Heideggers Metaphorik der "Holzwege" (1950) ein. Auch davon führen bekanntlich viele durch denselben Wald, und manche verlieren sich im Dickicht, zumal für den, der sich nicht auskennt.
Bei Jauß erfährt man explizit erst auf Seite 300, aus einem Brief an Paul de Man, daß der späte Heidegger nicht zu dem Paradigma gehört, dem sich der Konstanzer verschrieben hat, weil jener "dem großen Dichter ein eigenes Verhältnis zur Wahrheit, dem Kunstwerk ein ~~'selbstgenügsames Anwesen' zuerkannte". Das kann natürlich nicht angehen, der pluralistischen Hermeneutik entkommt niemand so schnell, noch das gründlichste Mißverstehen gehört zu ihrer Domäne. Daß Jauß' Verstehenswege nicht im Wald verlaufen, sieht man allerdings schon auf dem Titelbild des Bandes (einer Gouache von Matthias Holländer), auf dem ein Korridor mit lauter offenen Türen dargestellt ist.
Obwohl Verstehen auch von Jauß nicht erzwungen werden kann, wird bei der Apologie der literarischen Hermeneutik doch von Waffen gesprochen, nämlich von denen der "Widersacher", welche gegen sie selbst gewandt werden sollen. Das ist natürlich auf ironische Weise so theologisch und scholastisch gemeint wie die Widmung "Ad dogmaticos". Den "Verdacht der Häresie" will Jauß dabei gelassen in Kauf nehmen, was angesichts des Fehlens einer durchsetzungskräftigen Inquisition nur mäßig mutig erscheint. Ob in den Zimmern mit den offenen Türen die Dogmatiker hausen, kann man auf Holländers Bild nicht erkennen. Sonst wüßte man wenigstens, wo sie alle geblieben sind.
Für den Fall, daß es tatsächlich keine mehr geben sollte, kann die postideologische Hermeneutik virtuell für Abhilfe sorgen: Wer die Hermeneutik verachtet, weil er sie zum Beispiel "für herrschaftsstabilisierend, für subjektivistisch, unsystematisch und theorieblind hält, kann seinerseits in Dogmatismus verfallen". Bei solchen Dogmatikern kann es anscheinend genügen, daß man ihnen die Instrumente zeigt. Angedroht wird vor allem die Erfahrung des praktischen Lebens. Ein Anti-Hermeneut wäre Jauß zufolge "gleichermaßen unfähig, sich nach einem Weg zu erkundigen, einen Gruß von einer Drohgebärde zu unterscheiden, geschweige denn eine rhetorische Frage zu erkennen oder sich auf eine Argumentation einzulassen".
Daß die Gemeinten wenigstens auf der "Spielwiese der Theorie" eine Drohgebärde identifizieren können, scheint Jauß ihnen bei all ihrer Unreflektiertheit aber zuzutrauen. So wenn er den dekonstruktivistischen Begriff der Unentscheidbarkeit als unzulässige Abweichung von der Normalität brandmarkt: "Daß aus einer Grenzerscheinung menschlicher Kommunikation unterderhand ihr Normalfall konstituiert wurde, kann man als Dilemma des Verfahrens der Dekonstruktion zwar verstehen, ihren Adepten aber nicht einfach nachsehen." Das klingt nur so gefährlich. Die solchermaßen eingeschüchterten Dogmatiker werden später doch wieder ins hermeneutische Haus gelassen. Oder sollten es rein rhetorische Fragen sein, die Jauß Paul de Man im erwähnten Brief stellt? "Stehen wir beide nicht eher auf der Seite der ,Modernes', die das zu stürzende Idol der ,Anciens' in der platonischen Triade. erkannten? Die Befreiung von diesem platonischen Erbe ist für mich das Werk der ästhetischen Erfahrung. Wenn es für Sie das Werk der poetischen oder rhetorischen Analyse ist, meinen wir dann unter verschiedenen Namen nicht nahezu das Gleiche?" Da scheint der Dogmatiker schon keiner mehr zu sein. Aber vielleicht macht es ja einen Unterschied, daß hier von einem Schulhaupt zum anderen geredet wird.
Mit dem Abdruck des Briefes möchte Jauß Paul de Mans Werk auf der "Weltkarte der Gelehrtenrepublik" markieren. Welche Grenzen dort eingezeichnet sind, hätte man gern erfahren. Denn da die literarische Hermeneutik Jaußscher Prägung so vorbehaltlos als grenzüberschreitend konzipiert ist, läßt sich der Verdacht nicht abweisen, daß jene Karte mit der des hermeneutischen Friedensreichs identisch ist, in dem die Sonne nie untergeht. Unter dieser Sonne gibt es nämlich nichts wirklich Neues. Der amerikanische New Historicism etwa Stephen Greenblatts kommt Jauß vor wie "alter Wein in neuen Schläuchen". Das soll heißen: Die zentralen Fragen, etwa die, in welcher Weise eine Dichtung in ihrer Zeit situiert ist und wie sie diese übersteigt, sind zumal in der deutschen Tradition schon qualifizierter gestellt und wohl auch beantwortet worden.
Manches hat man lange hinter sich, an anderes braucht man nicht erinnert zu werden, weil man "diese Auffassung von Anfang an vertreten hat". Am Ende versteht sich Jauß auch mit dem New Historicism, ob der will oder nicht. Auch hier gilt, was Jauß zur Schlichtung des neuen Streits der Fakultäten und Disziplinen ans Ende seiner Darstellung setzt: "daß Grenzen nicht notwendig trennen müssen, sondern stets auch Horizonte vermitteln und ineins damit das Einvernehmen der Wissenden und der Handelnden befördern können".
Ist das die postideologisch erneuerte Erwartung einer "Symphonie der Professoren" in einer pluralistischen, gar multikulturellen Gesellschaft? Oder die Warnung vor der Aufkündigung der Tonika-Rückbindung, ein freundlich vermittelter Machtanspruch, der im hinkünftigen Friedensreich keine autonomen Provinzen dulden mag? Das ist bei Jauß ähnlich schwer zu unterscheiden wie im System der westlichen Demokratien. Gerade deshalb sollte man Jauß' "Wege des Vestehens" unbedingt noch einmal betreten; denn wo wäre über dieses, für das (aller Postmoderne zum Trotz) noch nicht völlig verschwundene Individuum entscheidende Problem des Verstehens mehr an Kenntnissen versammelt als bei dem Konstanzer Kosmopoliten? Ob dem Leser alle Türen des Hauses offenstehen, wie es der Titelumschlag verspricht, oder ob es nicht doch eine verbotene Kammer gibt, wird sich der Leser bei der Relektüre fragen müssen.
Hans Robert Jauß: "Wege des Verstehens". Wilhelm Fink Verlag, München 1994. 435 S., br., 68,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main