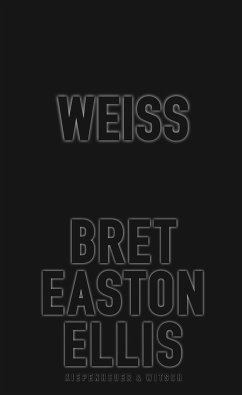Bret Easton Ellis beobachtet sich selbst und sein Land
In »Weiß« verbindet Bret Easton Ellis autobiografische Erlebnisse mit schonungslosen Beobachtungen und Erfahrungen, die er mit der amerikanischen Gesellschaft in den letzten Jahren gemacht hat. Eine Polemik gegen den grassierenden PoliticalCorrectness-Wahn in den USA und zugleich eine Verteidigung von Meinungs- und Kunstfreiheit.
Berühmt und berüchtigt - das trifft auf Bret Easton Ellis wie auf keinen anderen Autor zu. Seit seinem ersten Roman »Unter Null«, der ihn 1985 über Nacht zum Star machte, sammelt er Fans wie Feinde um sich, und spätestens mit seinem Roman »American Psycho« und der Figur des Patrick Bateman gilt er in nicht wenigen Ländern als Skandalautor. Viele Jahre liegen seit seiner letzten Veröffentlichung zurück. Jahre, in denen er sich nur über Twitter und Podcasts geäußert hat. In seinem neuen Buch denkt er nach über seine eigenen Werke, ihre Entstehungen und Wirkung, über Filme, die er sieht, und Menschen, die er trifft . Er spricht Dinge aus, die manch einem in seinem Umfeld nicht gefallen werden, und das mit scharfzüngiger Ironie.
Ein Memoir, das es in sich hat: ein Selbstporträt und eine leidenschafliche Reflexion über Kunst in unserer Zeit.
In »Weiß« verbindet Bret Easton Ellis autobiografische Erlebnisse mit schonungslosen Beobachtungen und Erfahrungen, die er mit der amerikanischen Gesellschaft in den letzten Jahren gemacht hat. Eine Polemik gegen den grassierenden PoliticalCorrectness-Wahn in den USA und zugleich eine Verteidigung von Meinungs- und Kunstfreiheit.
Berühmt und berüchtigt - das trifft auf Bret Easton Ellis wie auf keinen anderen Autor zu. Seit seinem ersten Roman »Unter Null«, der ihn 1985 über Nacht zum Star machte, sammelt er Fans wie Feinde um sich, und spätestens mit seinem Roman »American Psycho« und der Figur des Patrick Bateman gilt er in nicht wenigen Ländern als Skandalautor. Viele Jahre liegen seit seiner letzten Veröffentlichung zurück. Jahre, in denen er sich nur über Twitter und Podcasts geäußert hat. In seinem neuen Buch denkt er nach über seine eigenen Werke, ihre Entstehungen und Wirkung, über Filme, die er sieht, und Menschen, die er trifft . Er spricht Dinge aus, die manch einem in seinem Umfeld nicht gefallen werden, und das mit scharfzüngiger Ironie.
Ein Memoir, das es in sich hat: ein Selbstporträt und eine leidenschafliche Reflexion über Kunst in unserer Zeit.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Marc Neumann skizziert zunächst, wie kontrovers das Buch in Amerika aufgenommen wurde. Die modischsten Kolumnisten - Bari Weiss aus der New York Times etwa oder Isaac Chotiner vom New Yorker - haben sich gegen Ellis' Essays gewandt, weil er einfach nicht die Codes der heutigen Betroffenheitslyrik einhalten will. Es ist halt das Buch eines Autors der Generation X aus den knallbunten Achtzigern, der sich an den Schneeflocken aus der Millennial-Generation abarbeitet und diesen und den mit ihr verbündeten Medien kein so gutes Zeugnis ausstellt, so der Rezensent. Das ist toll, wenn auch politisch zwiespältig und manchmal sogar raffiniert, findet Neumann, der mit Ellis' Kritik an der "Entrüstungswirtschaft" wohl einiges anfangen kann. Neumanns Ausführungen zum Titel des Buchs, "Weiß", der entscheidend sei, lesen sich besonders interessant: Kann man denn tatsächlich behaupten, wie Ellis es laut Neumann tut, dass die Sprachrohre der Millennials alle weiß seien? Wie auch immer: Neumann findet es interessant, dass Ellis den Kern des Weißseins nicht wie die Millennials in historischer Schuld, sondern in der Kulturgeschichte der letzten vierzig Jahre sucht. Am Schluss lobt Neumann noch Ellis' Ehrlichkeit.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Bret Easton Ellis sieht schwarz für Amerika: "Weiß", sein neues Buch, ist Autobiographie, Suada und Hommage an Joan Didion
Es ist, in diesen Tagen jedenfalls, womöglich das größte Unglück des Bret Easton Ellis, dass er nicht Joan Didion ist - jene amerikanische Schriftstellerin, die er verehrt, bewundert, immer wieder zitiert; der er, ganz offensichtlich, nachstrebt in seinem neuen Buch. Und deren Können und intellektuelle Eleganz für ihn, um das schon mal auszusprechen, doch unerreichbar bleiben.
Es ist aber ganz sicher auch das Glück seiner Leser, dass Bret Easton Ellis nicht Joan Didion ist. Denn Joan Didion gibt es ja; und es war Bret Easton Ellis in der Rolle als er selbst, der "Unter Null" geschrieben hat, "American Psycho", Glamorama", "Lunar Park", lauter Romane, welche die Konflikte und die Widersprüche ihrer Zeit nicht beschrieben und schon gar nicht reflektiert haben. Aber verstärkt und angeheizt, gesteigert und radikalisiert, bis das Gefährliche, das Unversöhnliche und Unauflösliche überdeutlich sichtbar wurden.
Joan Didion, nur zur Erinnerung, ist inzwischen 84 Jahre alt - und kaum jemand in der englischen oder irgendeiner anderen Sprache beherrschte und beherrscht so gut wie sie die Kunst, aus Anschauung, Autobiographie und den eigenen Reflexionen darüber eine Prosa zu formen, die nicht nur ungeheuer präzise und unwiderstehlich elegant ist. Sondern die es schafft, mit ihrem Ton, ihrer Melodie, ihrem Rhythmus auf Stimmungen und Gefühle zu verweisen, die sich vor den Begriffen verschließen. Einig immerhin sind sich Didion und Ellis in dem Anspruch, dass guter, sicherer Stil ein universales Konzept ist. Man sollte ihn nicht nur schreiben, man muss ihn auch verkörpern können. "The White Album" heißt (im Original) ihr berühmtester Essay, in dem es um Kalifornien als geistige und politische Lebensform geht. "White" heißt (ebenfalls im Original) Bret Easton Ellis' neues Buch, das ein sehr ähnliches Thema hat. Und sich an einer ähnlichen Methode versucht. Anschauung, Autobiographie. Und ein Denken, das mit sich selbst ganz allein ist, weil es sich nicht anlehnen mag (oder kann) an stabile, gut abgesicherte und überprüfte Theorien.
Einmal, vor sehr langer Zeit, hat Ellis die Einladung bekommen, Joan Didion zu werden: So kann man jedenfalls eine Geschichte verstehen, von der Ellis auf ein paar Seiten im ersten Drittel des Buchs erzählt. Es war um die Mitte der achtziger Jahre herum, Ellis war Anfang zwanzig, studierte in Neuengland, war aber, weil "Less than Zero" gerade erschienen war, unter den Lesern seiner Generation fast schon weltberühmt. Tina Brown wollte ihn kennenlernen, die damals schon legendäre Chefredakteurin von "Vanity Fair" (die später noch legendärer wurde, als Chefredakteurin des "New Yorker"). Sie trafen sich in der Bar des Hotels "Algonquin" in der 44. Straße (wo einst der berühmte "Algonquin Round Table" um Dorothy Parker und den "New Yorker"-Gründer Harold Ross regelmäßig getagt hatte), und Tina Brown sprach Ellis auf einen Artikel im Magazin "New York" an, das schon immer ein bisschen schneller als die berühmteren New Yorker Zeitschriften war. Es ging darin ums Brat Pack, jene Gruppe damals sehr junger Schauspieler rund um Molly Ringwald, Charlie Sheen, Demi Moore, Judd Nelson (und nur einige zu nennen): Der Artikel war unfair, bösartig, hatte aber viel Wirbel gemacht und den Namen "Brat Pack", also Bande von Rotzlöffeln, überhaupt erst erfunden. Ob er sich vorstellen könne, über Judd Nelson, der gerade zwei Hits gehabt hatte mit "St. Elmo's Fire" und "The Breakfast Club", ein Porträt zu schreiben, gerne kritisch, gerne böse, im kalten Bret-Easton-Ellis-Sound. Der junge Ellis, so erzählt der alte, sei dagesessen, habe zugehört, wenig gesagt, schließlich zugestimmt, weil ihm kein Ablehnungsgrund einfiel. Und dann traf er sich mit Judd Nelson, fand den Schauspieler sympathisch, klug, interessant - aber statt genau daraus etwas zu machen, statt also in Nelsons Filmen und in Nelsons Jugend nach einer Wahrheit über Kalifornien, das Starsystem und die Fiktionsindustrie der Achtziger zu graben, verbündete sich Ellis mit Nelson, und gemeinsam beschlossen sie, sich über "Vanity Fair" lustig zu machen. Statt des Starporträts verkaufte Ellis der Redaktion eine Story über die coolsten und geheimsten Orte in Los Angeles, die Bars und Restaurants, in welchen das Brat Pack und andere hippe, junge Menschen angeblich herumhingen. Die Zeitschrift schickte extra einen Fotografen aus New York. Und dann posierten Nelson und Ellis, in schicken Anzügen und in glamourösem Schwarzweiß vor Pizzerien und Imbissläden, in denen die Stammgäste von Demi Moore, Charlie Sheen und diesem ganzen Brat Pack noch nie auch nur gehört hatten.
Aus Judd Nelson ist dann doch kein großer Star geworden, nur ein Schauspieler, der seine halbguten Jobs einigermaßen gut zu machen versucht. Der Schwindel flog bald auf, und Ellis bekam nie wieder einen Auftrag von "Vanity Fair". Und eine Joan Didion ist auch nicht aus ihm geworden.
Was aber aus ihm geworden ist, ein paar Romane und viele unverfilmte Drehbücher, Drehbuchentwürfe und genau 2589 Tweets später: Das ist eine Figur, die man sehr gern von Joan Didion, wenn sie noch für Magazine schriebe, porträtiert sähe: Ein Mann, der seit zehn Jahren nicht mehr die Kraft aufgebracht hat, seiner Unversöhntheit, seiner Wut und vor allem seiner Fremdheit im Amerika der Gegenwart die Form eines Romans zu geben im immer noch sehr zeitgemäßen Bret-Easton-Ellis-Stil: knappe Sätze, knappe Dialoge, alles im Präsens, weil das Imperfekt die Milde des Erinnerns in die Prosa brächte, was die Unversöhntheit und die Fremdheit zu sehr herunterdimmen würde.
Bret Easton Ellis, das wissen wir leider nicht aus Joan Didions nicht geschriebenem Porträt, sondern müssen es uns selbst zusammenreimen aus den Selbstbeschreibungen seines Buchs, Bret Easton Ellis sitzt gerne nachts, wenn sein viel jüngerer Lebensgefährte längst eingeschlafen ist, allein an seinem Computer, hat einen Drink neben sich, und dann schickt er seine Tweets hinaus in die Nacht, die man sich nicht bloß dunkel, sondern "noir" (wie das kalifornische Fachwort heißt) vorstellen muss, meistens sehr böse Tweets, in denen er Schriftstellerkollegen, Regisseure, Schauspieler und sehr gerne auch jene jungen Menschen, die er nicht Millennials, sondern "Generation Wuss" nennt, also Schwächlinge, Nullen, Waschlappen, Weicheier, so heftig beleidigt, dass man manchmal gar nicht anders kann, als sich den Verfasser als einen bösen, verbitterten und langsam alternden Mann vorzustellen.
Und es wäre die Pointe des nicht geschriebenen Porträts von Joan Didion, dass es Ellis' Nächte so beschriebe, dass Ellis darin als ein Mann erschiene, dessen nächtliche Tweets so laut und so böse sind, nicht weil ihr Verfasser so böse ist; sondern weil ihn die Angst plagt, der Gegenwart verloren zu gehen. Weil er gehört werden und womöglich ein paar Antworten bekommen will. Und der doch weiß, dass fünfhundert sogenannte Likes auf Twitter, auch wenn sie die Form von roten Herzen haben, ihn von seiner intellektuellen Einsamkeit nicht erlösen werden.
"Weiß" heißt das Buch natürlich nicht nur wegen Joan Didion. "Alt" und "Mann", die beiden Worte darf man gern ergänzen - und die Prosa dieses alten, weißen Mannes ist umso besser, je weiter sie sich von der Gegenwart entfernt. Wenn Ellis aus seiner Kindheit erzählt, von einem Jungen aus der Mittelschicht im San Fernando Valley, der nicht auf Schritt und Tritt überwacht und behütet wurde; der aber vor allem als Leser und Kinogänger geschildert wird, als einer, der die verbotenen Romane an einem Nachmittag liest und der kein Kinogenre so hoch schätzt wie die Horror- und Splatterfilme, deren Schocks er, wie er gesteht, gefürchtet und doch immer wieder gesucht habe; und als seine Kindheit zu Ende ging, habe er gewusst, wie er an der Herausforderung dieser Filme erstarkt und gewachsen sei: Dann mag man ihm gerne folgen - ganz ohne dass dabei alle, die das anders sehen, als Weicheier beschimpft werden müssen.
Und wenn Ellis, der eben nicht nur weiß und ein Mann, sondern auch homosexuell ist, sich seitenlang an "American Gigolo" erinnert, einen Film, den er (zu Unrecht) für kein Meisterwerk hält; der aber offenbar für ihn so wichtig wie kaum ein anderer war, wegen seiner Sicht auf die Oberflächen der Menschen und der Dinge; wegen seines Helden Richard Gere, der hier so deutlich und direkt und unwiderstehlich als Objekt der Schaulust und des Begehrens inszeniert wird, wie Ellis das noch nie gesehen und empfunden hat: Dann ist das nicht nur eine sehr schöne, kluge, richtige Art, Filmgeschichte als Geschichte der Wirkungen, Affekte und der Imitationen des Kinos durch das Leben zu schreiben. Man wünscht sich auch, Ellis hätte genau so weitergemacht: eine Autobiographie des Lesers und Kinogängers, die man, wenn man zur selben Generation gehört, mit der eigenen Autobiographie als Leser und Kinogänger wunderbar kurzschließen kann. Und wenn man jünger ist, wäre es die Vorgeschichte, die man kennen sollte. Wobei die Schocks und Erschütterungen, die der ultrakapitalistische Serienkillerroman "American Psycho" bewirkt, nicht schwächer werden, wenn einem beim Lesen des Horrorfilmkapitels bewusst wird, wie direkt Ellis da häufig einfach Filmszenen in Literatur übersetzt.
Ja, darauf läuft das ganze Buch hinaus, alle Kunst muss Zumutung, Herausforderung, Belästigung, Verstörung sein. Und jeder, der sich und womöglich auch allen anderen diese Herausforderungen und Zumutungen ersparen will, ist Ellis' Gegner: in moralischer wie, vor allem, in ästhetischen Dingen. Im Amerika der Gegenwart aber, das Ellis "Post Empire" nennt, weil das "Empire" spätestens im September 2001 kollabiert sei, in dieser Gegenwart gebe es viel zu viel Vorsicht, Betulichkeit, Angst, Betreuung, Konfliktscheu, Hang zum Beleidigtsein, Lust, sich selbst zum Opfer zu erklären. "Wenn Sie eine weiße Amerikanerin sind, die Shakespeare oder Melville oder Toni Morrison nicht lesen kann, weil es irgendetwas Schädliches in ihnen ,triggern' könnte und weil solche Texte Ihre Hoffnung untergraben, sich durch Ihre Opferrolle definieren zu können, dann sollten Sie einen Arzt aufsuchen, Konfrontationstherapie beginnen oder Medikamente nehmen." Stimmt ja alles; wäre, anscheinend, vor allem an den Universitäten ein Satz, den man gar nicht oft und laut und nachdrücklich genug sagen kann. Und dass Ellis aber, wenn er all die Betulichkeit und Selbstviktimisierung beklagt, immer wieder, seitenlang, im Namen der Kunst und der Freiheit (statt eben den nächsten provokanten, herausfordernden, gefährlichen Roman zu schreiben, der mit hundertprozentiger Sicherheit in allen großen Zeitungen prominent besprochen würde), dabei einen riesigen performativen Widerspruch produziert, das merkt man nicht nur daran, wie locker ihm das Wörtchen "faschistisch" sitzt, wenn er seine Gegner beschimpfen will. Man merkt es ganz besonders schmerzlich, wenn er eine klammheimliche Freude am Stil von Donald Trump beschreibt - so, als ob der Präsident ein Widerstandskämpfer gegen die herrschende Diktatur der Opfer und Beleidigten wäre.
Ach, Ellis' Erfolg ist Ellis' schärfstes Dementi. "Der Blick durch die Windschutzscheibe eines gestohlenen Autos, ein blutiger Autounfall, ein Geheimnis, das enthüllt wird (. . .) Andeutungen eines Mordes, der als Selbstmord verschleiert wird, jemand gibt vor, jemand zu sein, der er nicht ist, ein Schauspieler." So, schreibt Ellis im Vorwort, ginge der nächste Roman los, falls er ihn schreiben würde. Könnte ein Desaster werden. Oder eine Zumutung. Er müsste sich halt endlich aufraffen.
CLAUDIUS SEIDL
Bret Easton Ellis: "Weiß". Aus dem amerikanischen Englisch von Ingo Herzke, Kiepenheuer & Witsch, 320 Seiten, 20 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Selten hat jemand in dieser Schärfe die Geschichte der westlichen Kultur der vergangenen 30 Jahre umrissen.« Aachener Nachrichten 20190506
Gespräche mit
Schwerhörigen
Das neue Buch von Bret Easton Ellis, eine Sammlung von Essays über die Gegenwart, fühlt sich an wie ein Dialog, den man nie führt, weil man sich abgewöhnt hat, mit Menschen zu diskutieren, die andere Ansichten haben als man selbst. In den sozialen Netzwerken stellt man sie stumm, im Alltag begegnet man sich nicht, bei Familienfesten setzt man sie an den Tisch mit den Schwerhörigen. Es gibt den Typ Garant-für-schlechte-Laune, und in den letzten Jahren konnte man den Eindruck gewinnen, dass Bret Easton Ellis einiges daransetzt, als genau der zu gelten. Nur kommt er damit nicht durch. Denn es macht ungeheuren Spaß, seinen Ausführungen zu folgen, die schon mal die Trampelpfade des Sich-politisch-auf-der-guten-Seite-Wissens für ein paar gut gelaunte Schlenker verlassen, dabei bestechend logisch sind und von schillernder Schönheit. So führt er vor, wie lächerlich man selbst ist, wenn man sich über jeden einzelnen Fehltritt Trumps aufregt. Trump wurde demokratisch gewählt, wer damit nicht zurechtkomme, findet Ellis, verhalte sich wie ein Baby. Im normalen Leben würde man sich an der Stelle eventuell an einen anderen Tisch setzen. Doch Ellis gelingt das Kunstwerk, mit seinem Leser in ein Gespräch zu kommen, das interessanter und auch lustiger ist als die meisten Gespräche, die man in diesem Sommer sonst führen wird.
JOHANNA ADORJÁN
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Schwerhörigen
Das neue Buch von Bret Easton Ellis, eine Sammlung von Essays über die Gegenwart, fühlt sich an wie ein Dialog, den man nie führt, weil man sich abgewöhnt hat, mit Menschen zu diskutieren, die andere Ansichten haben als man selbst. In den sozialen Netzwerken stellt man sie stumm, im Alltag begegnet man sich nicht, bei Familienfesten setzt man sie an den Tisch mit den Schwerhörigen. Es gibt den Typ Garant-für-schlechte-Laune, und in den letzten Jahren konnte man den Eindruck gewinnen, dass Bret Easton Ellis einiges daransetzt, als genau der zu gelten. Nur kommt er damit nicht durch. Denn es macht ungeheuren Spaß, seinen Ausführungen zu folgen, die schon mal die Trampelpfade des Sich-politisch-auf-der-guten-Seite-Wissens für ein paar gut gelaunte Schlenker verlassen, dabei bestechend logisch sind und von schillernder Schönheit. So führt er vor, wie lächerlich man selbst ist, wenn man sich über jeden einzelnen Fehltritt Trumps aufregt. Trump wurde demokratisch gewählt, wer damit nicht zurechtkomme, findet Ellis, verhalte sich wie ein Baby. Im normalen Leben würde man sich an der Stelle eventuell an einen anderen Tisch setzen. Doch Ellis gelingt das Kunstwerk, mit seinem Leser in ein Gespräch zu kommen, das interessanter und auch lustiger ist als die meisten Gespräche, die man in diesem Sommer sonst führen wird.
JOHANNA ADORJÁN
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de