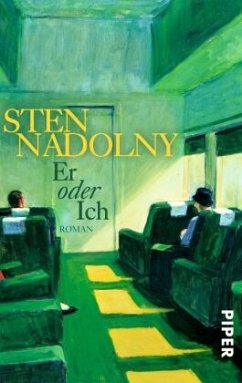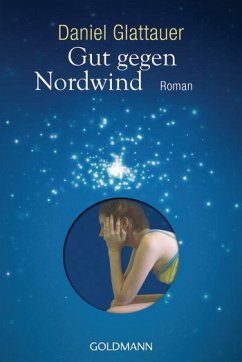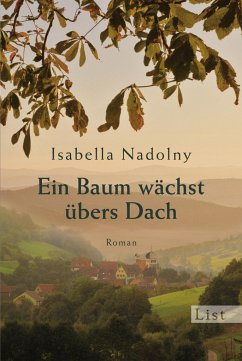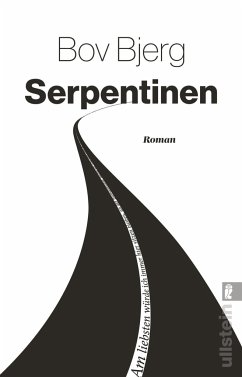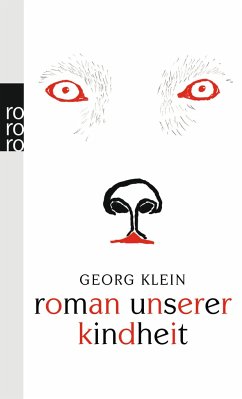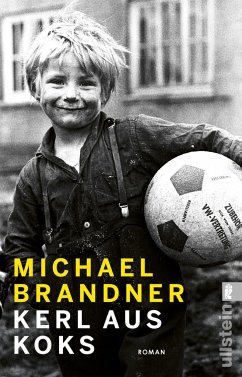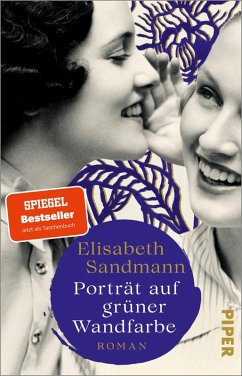Sten Nadolny
Broschiertes Buch
Weitlings Sommerfrische
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Als der angesehene Richter Wilhelm Weitling in einem Chiemseesturm mit seinem Segelboot kentert, kommt er gerade so mit dem Leben davon. Doch das Unglück versetzt ihn zurück in die eigene Jugend. Für den verblüfften Weitling wird dieses Abenteuer zur philosophischen Zeitreise - und hat unerwartete Auswirkungen auf seinen scheinbar vorgezeichneten Lebenslauf.
Sten Nadolny wurde 1942 in Zehdenick an der Havel geboren. 1983 gelang ihm mit 'Die Entdeckung der Langsamkeit' ein Welterfolg. Daraufhin erschienen die Romane 'Selim oder Die Gabe der Rede', 'Ein Gott der Frechheit', 'Er oder ich', der 'Ullsteinroman', und zuletzt 2009 der gemeinsam mit Jens Sparschuh verfasste Gesprächsband 'Putz- und Flickstunde'. Sten Nadolny lebt in Berlin und am Chiemsee. Sein literarisches Werk ist vielfach preisgekrönt und in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Produktdetails
- Piper Taschenbuch Bd.30307
- Verlag: Piper
- 6. Aufl.
- Seitenzahl: 218
- Erscheinungstermin: 14. Mai 2013
- Deutsch
- Abmessung: 191mm x 121mm x 19mm
- Gewicht: 220g
- ISBN-13: 9783492303071
- ISBN-10: 3492303072
- Artikelnr.: 36806342
Herstellerkennzeichnung
Piper Verlag GmbH
Georgenstr. 4
80799 München
info@piper.de
»Ein Buch über die verlorene Identität und eine poetische Zeitreise durch das Leben des Autors als multiple Persönlichkeit.« Radio Bremen, Literaturzeit 20121008
Multiple Identität
In seinem verschiedentlich als Alterswerk apostrophierten Roman «Weitlings Sommerfrische» beleuchtet Sten Nadolny das Problem menschlicher Identität mit Hilfe einer Zeitreise, hier sogar in beiden möglichen Varianten, zurück und voraus. Die …
Mehr
Multiple Identität
In seinem verschiedentlich als Alterswerk apostrophierten Roman «Weitlings Sommerfrische» beleuchtet Sten Nadolny das Problem menschlicher Identität mit Hilfe einer Zeitreise, hier sogar in beiden möglichen Varianten, zurück und voraus. Die Identität aber, um die es sich konkret handelt, die des Protagonisten dieser Geschichte, ist so stark autobiografisch inspiriert, dass sich unwillkürlich die Frage aufdrängt, ob die vom Autor gewählte Form der philosophischen Zeitreise in beide Richtungen für die Aufarbeitung der eigenen Biografie und für den beabsichtigten Erkenntnisgewinn beim Leser wirklich optimal ist.
In den ersten beiden der neun Kapitel dieser Geschichte berichtet ein auktorialer Erzähler von dem pensionierten Richter Dr. Wilhelm Weitling aus Berlin, der am Chiemsee in einem angemieteten Sommerhaus den wohlverdienten Ruhestand genießt. Bei einem Segeltörn mit seiner Plätte, einem zum Segelboot umgebauten Fischerkahn, gerät er in einen Sturm und kentert, ein Blitz schlägt in seiner Nähe ein. Im dritten Kapitel wechselt abrupt die Erzählperspektive, der sechzehnjährige Willy wird 1958 mit seinem manövrierunfähigen Boot im Sturm an das Ostufer des Chiemsees getrieben. «Wenn es Gott gäbe, hätte er bei dieser Rettung die Hand im Spiel gehabt». Der das denkt ist aber nicht Willy, «sondern nach wie vor der alte Mann aus Berlin, aber für andere unsichtbar, Geist ohne Physis, gekettet an einen Sechzehnjährigen aus Stöttham bei Chieming». Das Trauma durch den Blitz hat Weitling in die Vergangenheit zurückgeschleudert.
Was folgt ist eine Zeitreise an der Seite von Willy als Pennäler, den er unsichtbar mehrere Monate lang durch sein Leben begleitet und dabei wieder auf seine Eltern trifft, auf seine Jugendliebe. Er kann aber keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen und bleibt passiver Beobachter des Geschehens. Mit der Zeit weicht Willys Leben von Weitlings Erinnerung immer mehr ab, besonders gravierend erscheint dabei dessen Berufswahl, denn Willy will Schriftsteller werden, nicht Volljurist. Als Weitling glaubt, im Chiemsee die goldene Patrone gefunden zu haben, mit der General Patton 1945 persönlich den Führer erschießen wollte, die ihm aber dort aus der Hosentasche gefallen war und im See versunken ist, worauf hin er wütend in den See uriniert habe, da befördert das ungestüme Lachen über diese kuriose Anekdote Weitling wieder in die Gegenwart. Zu seinem Erstaunen aber in die abweichende Vita von Willy, er ist nicht mehr Richter und kinderlos, sondern Schriftsteller und inzwischen sogar Großvater, seine Identität hat sich geändert. Als zwei Jahre nach seiner Rückkehr aus der Vergangenheit seine Enkelin ihm nachts als Geist erscheint, als 68Jährige aus dem Jahr 2072 in die Gegenwart des Jahres 2012 zurückgekehrt, unterlässt er es bewusst, sie über die Zukunft auszufragen.
Nadolny erzählt seine phantastische Geschichte mit ihrem komplizierten Szenario in einem ruhigen, fast schon betulichen Ton mit einfach strukturierten Sätzen. Derart bedächtig, als wolle er «Die Entdeckung der Langsamkeit», den Titel seines erfolgreichsten Romans also, hier stilistisch tatsächlich mal realisieren. Das gemächliche Tempo des Plots nimmt gegen Ende geringfügig an Fahrt auf, ohne je thrillerartig zu werden, wobei die rätselhafte Geschichte über eine multiple Persönlichkeit durchaus selbstkritisch und mit unterschwelliger Ironie erzählt wird. Man kann diese «Versuchsanordnung» zur eigenen Identität, wie Nadolny selbst sie bezeichnet hat, als angenehm uneitle Autobiografie lesen, in der er mehr oder weniger sinnreiche philosophische Einsprengsel aus seiner eigenen Gedankenwelt verarbeitet hat. Der große Lesegenuss wollte sich bei mir trotz allem aber nicht einstellen, zu absurd, zu verkopft empfand ich diese Geschichte, zu wenige Emotionen weckend oder gar Empathie aufbauend. Zeitreise und multiple Identität als Vehikel einer Autobiografie zu benutzen erscheint mir nach dieser Lektüre tatsächlich suboptimal.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
"Weitlings Sommerfrische" ist in meinen Augen ein total gelungener, humorvoller und unterhaltsamer Roman mit gedankenvollen philosophischen Erkundungen.
Sehr oft stelle ich mir, während des lesen, die fragen : Welche Weichen würde ich stellen, wenn ich die Chance bekäme, …
Mehr
"Weitlings Sommerfrische" ist in meinen Augen ein total gelungener, humorvoller und unterhaltsamer Roman mit gedankenvollen philosophischen Erkundungen.
Sehr oft stelle ich mir, während des lesen, die fragen : Welche Weichen würde ich stellen, wenn ich die Chance bekäme, in meine vergangene Jugend zurück gehen zu können.....Mit den bereits gesammelten Erfahrungen.....
Was wäre passiert, wenn mein Schicksal anders verlaufen wäre, wenn ich andere Erfahrungen erlebt hätte.... wäre ich dann ein anderer Mensch als jetzt....??
Dieser Roman verführt den Leser , ausgeprägte und sehr tiefe Blicke in sein eigenes Leben zu werfen, in das Leben an und für sich.....Alle Sackgassen, die Verunsicherungen die jeden einzelnen von uns ein ganzes Leben, unter Umständen, begleiten.
Worum geht es:
Der pensionierte Richter Wilhelm Weitling lebt ursprünglich in Berlin und verbringt seinen Urlaub oder auch den groß teil seines Ruhestands an seinen Lieblingsort dem Chiemsee. Es ist für ihn ein Ort der Ruhe und Entspannung....
Eines Tages, den gesamten Wettervorhersagen und deutlichen Vorboten zum trotz, segelt er mit einem kleinen Segelboot hinaus auf dem Chiemsee. Wie nicht anderes erwartend gerät er in einen Sturm und kommt nicht mehr rechtzeitig ans rettende Ufer zurück und verunglückt schwer... Als Weitling wieder erwacht, muss er feststellen das er nicht im Krankenhaus ist sondern im Körper seines 16 jährigen ichs, als Geist.....
Mehr möchte ich nicht verraten. Selber lesen macht mehr Spaß
5 Sterne von mir. Dieses Buch kann man wirklich empfehlen.
Weniger
Antworten 10 von 11 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 10 von 11 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für