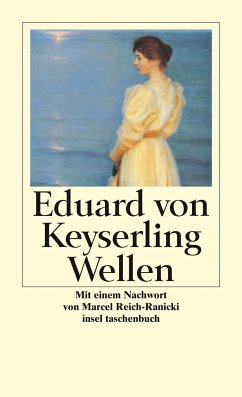Wellen ist eine Sommergeschichte, eine Liebeserklärung an die Ostsee, ein Porträt der baltischen Adelsgesellschaft um die Jahrhundertwende - und vor allem: eine Liebesgeschichte.
Die junge, schöne Doralice hat ihren Mann, einen alten Grafen, verlassen, um ein neues Leben mit dem Maler Hans Grill in einem Badeort an der Ostsee zu beginnen. Mit ihrem unkonventionellen Lebenswandel und der offen gelebten Beziehung zu dem Maler erschüttert sie das starre Moralbewußtsein der adligen Kurgäste, ist zugleich aber auch Objekt der Bewunderung und des Neids. Doch auch das Zusammenleben mit dem Künstler, das für Doralice zunächst die Erfüllung ihrer Sehnsucht bedeutet hatte, leidet mehr und mehr unter Mißverständnissen und gegenseitigen Empfindlichkeiten - beide können die Vergangenheit nicht einfach hinter sich lassen.
Das Auf und Ab ihrer Beziehung gestaltet Keyserling eindrucksvoll vor dem Hintergrund eines bewegten, die verschiedensten Stimmungen spiegelnden Meeres.
Die junge, schöne Doralice hat ihren Mann, einen alten Grafen, verlassen, um ein neues Leben mit dem Maler Hans Grill in einem Badeort an der Ostsee zu beginnen. Mit ihrem unkonventionellen Lebenswandel und der offen gelebten Beziehung zu dem Maler erschüttert sie das starre Moralbewußtsein der adligen Kurgäste, ist zugleich aber auch Objekt der Bewunderung und des Neids. Doch auch das Zusammenleben mit dem Künstler, das für Doralice zunächst die Erfüllung ihrer Sehnsucht bedeutet hatte, leidet mehr und mehr unter Mißverständnissen und gegenseitigen Empfindlichkeiten - beide können die Vergangenheit nicht einfach hinter sich lassen.
Das Auf und Ab ihrer Beziehung gestaltet Keyserling eindrucksvoll vor dem Hintergrund eines bewegten, die verschiedensten Stimmungen spiegelnden Meeres.

Eduard von Keyserlings Roman "Wellen" · Von Martin Mosebach
In seinem 1911 erschienenen Roman "Wellen" erschafft der baltische Erzähler Eduard von Keyserling eine eigentümliche Szenerie: Er läßt die Erzählung gleichsam am Rande des Kosmos spielen, auf einem weißen Sandstreifen, über dem sich, so scheint es, ein turmhoch aufsteigendes, mit dem Himmel verbundenes Meer erhebt. Die Menschenfiguren bewegen sich püppchengroß auf diesem Balkon zum Weltall. Sie sind gebannt von den Ausblicken ins Ungemessene und kehren dem Festland den Rücken zu, manchmal wagen sie auch Vorstöße ins Niemandsland und sind dann vollends von der gestaltlosen Riesenkraft der Wellen umgeben. "Wellen" ist das Werk eines Erblindeten - man muß nur die Augen schließen und in das eigene innere Dunkel blicken, um den Eindruck nachzuempfinden, am Rande einer körperlosen, von helleren und dunkleren Wogen bewegten Welt zu stehen.
Es gehörte zum Unglück Keyserlings, daß der Verlust des Augenlichts einen Menschen traf, der mit den Augen eines Malers sah. Maler sind wiederholt seine Helden, und die Vorgänge seiner Erzählungen werden häufig genug zu Beschreibungen von Gemälden. Die Russen der Jahrhundertwende pflegten in ihrer Landschaftsmalerei einen unverwechselbaren Stil, eine Weiterentwicklung des Impressionismus, deren Stimmung oft von einer feuchten Kälte regiert wird; frostig hellblaue Himmel über nassem Schlamm, von beständig wehendem Wind zerblasene Wolken, viel dickpastiges Bleiweiß.
Keyserling ist einmal von Lovis Corinth gemalt worden, mit glasig hervortretenden Augen im erschöpften blassen Gesicht, dessen einst vielleicht elegante Windhundmagerkeit längst kränklich wirkt. Aber die Bilder, die der blinde Autor entwirft und die zunächst aus der Schule seiner Zeitgenossen zu stammen scheinen, werden bald immer abstrakter. Wie Proust, der zur selben Zeit die Wirkung des Lichts auf den Wellen beschreibt, die sich in den Glastüren seines Hotelzimmers spiegeln, versenkt sich Keyserling in das unerschöpfliche Schauspiel des Meeres, wie es seine Erinnerung ihm reproduziert. Und diese sich erinnernde Nachschaffung der untergegangenen Farben gibt ihnen eine Deutlichkeit und ein Leuchten, die sie für die Sehenden wohl nur selten haben - das Türkis der stillen Wasserfläche im Sonnenglanz und das schaumige Schwarz der kochenden See während des Gewitters sind der Versuch, aus dem Wortklang Äquivalente für das allmählich in die Vergangenheit sinkende Gesehene herzustellen.
Hat Virginia Woolf, die ihren berühmtesten Roman "The waves" (1931) nannte und in ihm Menschenschicksal und Meereswellen in eine symbolische Beziehung setzte, womöglich Keyserlings Buch gekannt? Bei dem baltischen Autor sind die Wellen allerdings mehr als nur ein Symbol - im Verhältnis von Mensch und Natur bleibt die Natur der Sieger, die Wellen verschlingen die kleinen Menschen an ihrem Rande. Die Peinlichkeiten am Strand - man zögert, den Touristentod im Fischerboot eine Tragödie zu nennen - werden im Meeresbrausen hinweggefegt. Und doch nimmt der Autor das ferienmachende Menschenvölkchen, das wie die Ameisen und Bienen immerfort zusammenstrebt, dem es aber anders als den klugen Insekten so unendlich schwerfällt, zu einer haltbaren Ordnung zu finden, zwischen den Blicken auf die Wasserwüste hin und wieder genauer unter die Lupe.
Das Meer und der Strand sind archetypische Orte, haben aber auch einen gleichsam bürgerlichen Namen: die Ostsee an der kurländischen Küste mit ihren vielen Sandbänken. In einfachen, ja, ärmlichen Fischerhäusern in den Dünen haben sich Sommerfrischler eingemietet: eine Generalswitwe mit Tochter, Schwiegersohn, Enkeln und weiterem Anhang, ein buckliger Geheimrat, eine Gräfin, die ihrem Mann mit einem bürgerlichen Maler davongelaufen ist. Die Welt der deutschen Balten ist untergegangen, ihre besondere Art, deutsch zu sein, ist Legende geworden.
Der deutsche Adel von Kurland, Livland und Estland diente an den Höfen und in den Armeen Deutschlands und Rußlands und fühlte sich keinem der beiden Länder vollständig zugehörig. Das schuf eine Unabhängigkeit, die manchmal das Anarchische streifte. Weil Keyserlings Bücher in seiner Heimat Kurland im Milieu seiner Schicht spielen, und weil das Ende dieser deutsch-russisch-lettisch-estnischen Symbiose kurz bevorstand, hat man sich daran gewöhnt, seine Erzählungen im Zeichen dieses Untergangs zu lesen und sie als Zeugnisse einer sterbenden Welt aufzufassen. Aber wird man der Subtiliät Keyserlings gerecht, wenn man ihm das Klischeebild einer dekadenten Aristokratie als Leitmotiv seiner Erzählungen unterschiebt? Ist es überhaupt eine unter demselben Gesetz stehende Gesellschaft, die Keyserling da schildert?
Die Gräfin trägt einen polnischen Namen, Koehne-Jasky, die Generalin von Palikow ist die Witwe eines russischen Militärs, ihr Schwiegersohn Buttlär ist kurischer Gutsbesitzer, der Verlobte der Tochter ein reichsdeutscher Leutnant, der Geheimrat Knospelius hat der russischen oder deutschen Reichsbank gedient - deutlich wird das nicht. Man hat keinen der berühmten Ostseebadeorte aufgesucht mit Kurhaus und Promenade und Grandhotel, man treibt den Einsamkeits- und Naturkult, es ist wohl auch billiger so. Die alte Generalin ist Ancien régime bis auf die Knochen, unsentimental und kühl, ihre Tochter spießig, der Schwiegersohn ein tüchtiger Landwirt, der Leutnant ungezogen, die Tochter verschwärmt - dekadent ist niemand in diesem Kreis. Die ausgerissene Gräfin mit ihrem schönen blonden Maler ist allerdings eine schwankende Jugenstillilie, aber die Krankheit ihrer Seele hat einen Namen, der nicht nach adliger Überreife, sondern nach Kleinbürgertum riecht - der "Bovarismus", dieses Syndrom aus Sehnsucht, Verantwortungslosigkeit, Langeweile und Faulheit.
Die starren Gesellschaftsregeln, mit einer solchen Person keinen Umgang zu pflegen, werden glänzend rehabilitiert, als der verlobte Leutnant der Gräfin nachzustellen beginnt und seine Braut vor einem halb unfreiwilligen Tod in den Wellen gerettet wird. Die Gräfin Doralice hat Pech. Mit einem Künstler wollte sie auf den Wolken leben, aber der tüchtige Mann produziert brav täglich für seinen Münchner Galeristen und hofft auf ein Häuschen. Dann, erklärt er seiner Frau, "hast du dein Hauswesen, dem du dein Gepräge gibst". - Doralice zuckte mit den Achseln: "Ach Gott, ich kann doch nicht den ganzen Vormittag allein dasitzen und dem Hauswesen mein Gepräge geben." Sie werde Freunde finden, sagt der Maler, "du wirst Frauen finden, großzügige, freidenkende, edle Frauen . . ." "Diese Frauen kenne ich", bemerkte sie, "sie tragen Velveteen-Reformkleider und sprechen von objektiv und subjektiv."
Aber als die gesellschaftliche Peinlichkeit den Gipfel erreicht hat und der Maler als törichter Städter, der die Sturmwarnung mißachtet hat mit seinem ewigen Sport, ertrunken ist, hat die bucklige Exzellenz Knospelius freie Bahn bei der schönen Witwe. Beschädigt wie er selbst durchs Leben gehen muß, ist er Spezialist für beschädigte Ware; man wird sogar den Verdacht nicht los, daß er zur Blamage der Gräfin zielbewußt und im Hintergrund ein wenig beigetragen hat. Das Ancien régime in Gestalt der Generalin verkündet die trockene Moral der Geschichte: "Sich entführen lassen, das geht schnell . . . aber mit dem Herrn, der einen entführt, leben, das ist die Kunst."
Diese knappe Rekapitulation der Geschichte, die Keyserling erzählte, zeigt schon, daß es ihm um die Originalität seines Stoffes nicht zu tun sein konnte. Das ehebrecherische Paar, das sich durch die Normalität seines Außenseiteralltags quält, hat viele Vorläufer, darunter so große wie Anna Karenina und Graf Wronsky. Auch der hoffmanneske Dämon, der frauenlose Damenverehrer und Tröster im Unglück, ist eine Lieblingsfigur der Erzählungen des neunzehnten Jahrhunderts. Und weil sie alle so wohlvertraut sind, dürfen sie ganz knapp charakterisiert auftreten. "Wellen" ist ein Werk der eleganten, gelegentlich der verschwiegenen Andeutung. Die bekannte Anordnung der Figuren ist zart und geistreich variiert, die kleine Geschichte ist auf eine unauffällige Weise kompliziert. Anstatt seine Geschichte gleichsam mit hochgezogenen Augenbrauen und in Anführungszeichen zu erzählen, setzt Keyserling die Ironie nur als Gewürz ein, denn er weiß, daß die Anteilnahme des Lesers vor allem durch Herzklopfen erregt wird. Dem Menschen, so scheint er zu denken, wird durch Ironie nur Gutes getan, denn sie deckt viele Wunden zu, aber das Meer ist mit den Mitteln der Ironie nicht zu berühren.
Keyserling war lange Zeit kein vielgelesener Autor; wie er an der literarischen Tafel zwischen Raabe, Fontane und dem frühen Thomas Mann zu plazieren sei, ist nicht entschieden. Man kann Keyserling also wie einen neuen, einen soeben aufgefundenen Autor lesen, vielleicht mit dem Ergebnis, eine schon festgefügte Tischgesellschaft durcheinanderzubringen.
Eduard von Keyserling: "Wellen". Roman. Steidl Verlag, Göttingen 1998. 174 S., geb., 20,- DM. Deutscher Taschenbuchverlag, München 1998. 180 S., br., 12,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main