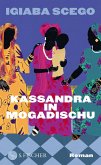Zum zweiten Mal ist er Vater geworden. In der einen Nacht will und will die kleine Tochter nicht aufhören zu schreien, und in der nächsten fragt er sich, ob sie noch atmet. Am Tag findet er sich zwischen Windeln und Fläschchen und dem Playmobil des ersten Kindes wieder. Und während seine Frau die Hauptverdienerin ist, träumt er von einem Leben in einem großen Haus am Meer oder von Sex mit anderen. Er ist überfordert als Vater, verunsichert als Mann. Wieso fällt es ihm so schwer, sich in seine Rolle einzufügen? Und welche dunklen Seiten hat sein Mann-Sein, welches Potenzial an Wut und Gewalt schlummert in ihm? Mit seinem Kind im Arm sucht er nach Antworten und findet Momente der Liebe, der Nähe und des Glücks.
Wellen ist ein Roman über das Auf und Ab im Alltag eines jungen Vaters, eine Auseinandersetzung mit dem Wunder des Lebens und der Liebe zum eigenen Kind. Er erzählt von einem modernen, um Gleichberechtigung bemühten Mann in einer Gesellschaft, in der immer noch alte Ideale und Geschlechterverhältnisse vorherrschen. Heinz Helles persönlichstes Buch und ein hochpoetischer Text von großer Kraft und Aktualität!
Wellen ist ein Roman über das Auf und Ab im Alltag eines jungen Vaters, eine Auseinandersetzung mit dem Wunder des Lebens und der Liebe zum eigenen Kind. Er erzählt von einem modernen, um Gleichberechtigung bemühten Mann in einer Gesellschaft, in der immer noch alte Ideale und Geschlechterverhältnisse vorherrschen. Heinz Helles persönlichstes Buch und ein hochpoetischer Text von großer Kraft und Aktualität!
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Rezensent Ekkehard Knörer erlebt mit den Büchern von Julia Weber ("Die Vermengung") und Heinz Helle ("Wellen"), wie die Autofiktion eine weitere Dimension erhält. Die beiden Schriftsteller sind ein Paar, sie haben zusammen Kinder bekommen und erzählen in ihren jeweiligen Büchern von ihrem gemeinsamen Leben. Man kann die beiden als Romane ausgewiesenen Bücher sehr gut unabhängig voneinander lesen, findet Knörer, es seien kluge Selbstbeobachtungen, mal mehr, mal weniger fiktionalisiert. Aber interessanter noch erscheint ihm, sie als "literarische Parallelaktion" zu verstehen und nachzuvollziehen, wie aus dem Du in dem einen Roman ein Ich im anderen wird und umgekehrt. Ausgesprochen raffiniert ist für Knörer dann die "doppelte Belichtung" einer Erfahrung, in der sich wiederum Leben und Schreiben vermengen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»... raffiniert und direkt. Die Nacktheit, in der sich die Ich-Figuren zeigen, berührt ...« Ekkehard Knörer taz. die tageszeitung 20221019