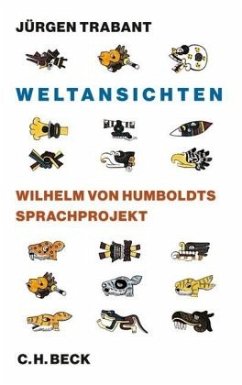Jürgen Trabant beschreibt die wichtigsten Etappen in der Entwicklung von Humboldts Sprachauffassung und diskutiert die Stellung dieses Sprachdenkens in Philosophie, Sprachwissenschaft und Anthropologie. In einer Zeit zunehmender Sprachvergessenheit möchte es nicht nur den sprachthematisierenden Disziplinen, sondern allen an Sprache Interessierten Humboldts großes und tiefes Sprachdenken zum Mit-Denken empfehlen. Wilhelm von Humboldt, der große Staatsmann und Gründer der Berliner Universität, war auch ein großer Sprachforscher. Er erkannte, dass Sprachen nicht nur verschiedene Laute sind, sondern dass sie die Bedeutungen jeweils unterschiedlich gestalten, dass sie - auf der Grundlage universeller kognitiver Dispositionen des Menschen - verschiedene Weisen menschlichen Denkens, verschiedene "Weltansichten" sind. Er entwirft ein umfassendes Projekt zur Erforschung der Sprachen der Welt, das gleichzeitig eine Erkundung der Vielfalt des menschlichen Geistes sein soll. Das vorliegende Buch skizziert die Reise Humboldts in die Sprachen der Welt und fragt nach den Folgen dieses anthropologischen Projekts für die heutige Reflexion und Kultur der Sprache.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit diesem Autor fühlt sich Thomas Thiel am Nabel der Sprachwissenschaft. Dabei weiß er, dass der Autor mit seiner essayistischen Präsentation von Humboldts ästhetischem Sprachverständnis eigentlich alte Suppen aufwärmt. Nur macht Jürgen Trabant das eben derart gekonnt, dass Thiel sich inmitten aktueller Diskurse um Relativismus, Universalismus und Naturalismus wähnt, mit Humboldt als Widersacher, der den kreativen, rhetorischen Akt des Sprechens verteidigt gegenüber Grammatik und Pragmatismus.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Jürgen Trabant bringt Wilhelm von Humboldts Sprachtheorie gegen Positionen heutiger Linguistik in Stellung
Wilhelm von Humboldt, Bildungstheoretiker, Staatsmann, Sprachphilosoph, hatte zuletzt Zuspruch von unerwarteter Seite. Mitglieder der Piratenpartei griffen in ihrem unendlichen Selbstfindungsprozess auch auf seine Schrift "Die Grenzen der Wirksamkeit des Staates" zurück, in der Humboldt für die Selbstbeschränkung des Staates im Namen individueller Entfaltung plädiert, ohne dem Staat seine generelle Leitungsfunktion streitig zu machen. Man findet diesen Gedanken auch in seiner Sprachtheorie. Es gibt universelle Gesetze, sagt er hier, Grundprinzipien, auf die jeder Sprecher Bezug nimmt, aber darunter oder darüber entfaltet sich das Reich der Einzelsprachen in seinen Farben und Nuancen. Das Allgemeine erkennt Humboldt an, das Individuelle feiert er.
Etwas zufällig schneit jetzt das Buch des Romanisten Jürgen Trabant herein, der schon viel über Humboldt geschrieben hat und seine Gedanken noch einmal essayistisch aufzubereiten scheint. Das Buch ordnet Humboldts Sprachperspektivismus aber so überzeugend in die linguistische Diskussion um Relativismus, Universalismus und Naturalismus ein, dass an seiner Aktualität gar kein Zweifel besteht.
Trabant bringt Humboldt als ästhetischen Widersacher der dominierenden Sprachtheorie in Stellung. Humboldt war im Grunde mehr Sprachästhet als Linguist. Seine Sprachforschung ist im Herzen eine Rhetorik. Humboldt sieht zwar die Notwendigkeit ein, die Sprache grammatisch zu zergliedern, erforscht selbst die amerikanischen Sprachen, das Baskische, die Kawi-Sprachen im Detail. Ihn interessiert aber vor allem die Vielfalt der Sprachen, ihr Stil, ihr Charakter. Jede Sprache ist für ihn eine Welt für sich.
Humboldt stellt sich damit gegen die klassische Zeichentheorie, die in der Sprache ein fixes Abbild sprachunabhängiger Realitäten sieht. Seit der babylonischen Sprachverwirrung war man gewohnt, Sprachvielfalt als Strafe zu empfinden. Humboldt sieht es anders. Sprache ist bei ihm ein schöpferischer Akt, der Wirklichkeit nicht nur abbildet, sondern in vielen Formen gestaltet. Nur in der Verkehrssprache unterhalten Sprache und Denken starre Verbindungen. Im höheren Gebrauch - und für ihn interessiert sich Humboldt vor allem - ist Sprache kein totes Gerippe, sondern ein lebender Organismus, der nicht nur Gegenstände beschreibt, sondern auch unsere Empfindungen, Wertungen und Interpretationen. Mit dieser Aufwertung der Rhetorik gegenüber der Grammatik ist Humboldt näher an der Philologie als an der Linguistik seiner Zeit.
Die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft, die sich damals mit Jacob Grimm und Franz Bopp formierte, ging den umgekehrten Weg zur Volkskunde und zur Naturwissenschaft. Sie sucht nach Gesetzen, klassifiziert, typologisiert. Sprache wird zum Naturgegenstand. Gleichzeitig geht man auf Distanz zur Philologie. Die naturwissenschaftlich orientierte Linguistik interessiert die Regel, nicht die literarische Ausnahme.
Humboldts kommt dagegen über die Anthropologie, weil er glaubt, humane Potentiale über die Sprache am besten fassen zu können. Seine Anthropologie setzt aber nicht bei "den Wilden", sondern bei den höchsten Ausdrucksformen an. Humboldt findet sie in der Antike und der Literatur. Das Regelwerk der Sprache bleibt ihm zwar wichtig, aber es ist nur die Vorbereitung für das Studium des Charakters der Sprache. Diese feinen Schwebungen kann man natürlich nur ahnen, aber nicht im objektiven Sinn erkennen.
Drei Gegner dieser Sprachhermeneutik sieht Trabant heute: Neben Naturalismus und der Esoterik, die als Auffangbecken der entsorgten Hermeneutik bereitsteht, ist der dritte der Relativismus. Der Gedanke, dass Sprache unser Denken bis ins Letzte beherrscht, ist gar nicht so alt, klingt im Realismus unserer Tage aber als die kuriose Erfindung einer weit zurückliegenden Epoche, die sich heillos in die Medialität des Denkens verstrickt hatte.
Trabant bezieht deutlich Position gegen einen Relativismus à la Sapir/Whorf, der das Individuum in seiner Nationalsprache geradezu festnagelte. Die Hopi-Indianer, behauptete Benjamin Whorf, könnten keine Zeit denken, weil ihre Sprache keine Tempusbestimmungen enthalte. Gleichzeitig wendet sich Trabant gegen den Umkehrschwung in einen platten Realismus. Die Sprache prägt und färbt das Denken. Sie ist aber kein störender Filter, wie die Philosophie ihr vorhielt, sondern eine kreative Kraft. Sie entfaltet das Denken.
Der Autor wendet sich mit Humboldt gegen eine kommunikativ-pragmatische Auffassung, die viel zu wenig zur poetischen Funktion der Sprache zu sagen hat. Und er kritisiert eine naturalistische Linguistik, die mit der Entdeckung von Sprachgenen alles über die Sprachen gesagt haben will. Auch die heutige kognitive Linguistik feiert Sprache wieder als Ausdruck des Geistes. Aber ihr mind ist nicht beweglich und kulturell gefärbt wie Humboldts Geist, sondern statisch und rational. Humboldts Geist weht nur, wo alle Gemütskräfte wirken.
Jürgen Trabant weiß natürlich, dass er hier von einem linguistischen Nicht-Ort aus mit einer Stimme aus einer vergangenen Zeit spricht. Aber er tut es so fulminant, dass man ihn für den Nabel der heutigen Sprachwissenschaft halten möchte.
THOMAS THIEL.
Jürgen Trabant: "Weltansichten". Wilhelm von Humboldts Sprachprojekt.
Verlag C. H. Beck, München 2012. 352 S., geb., 39,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main