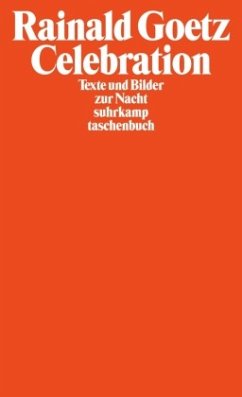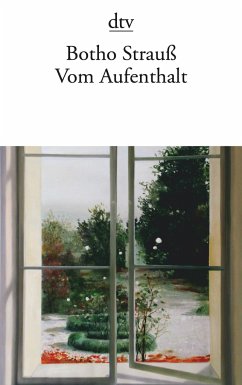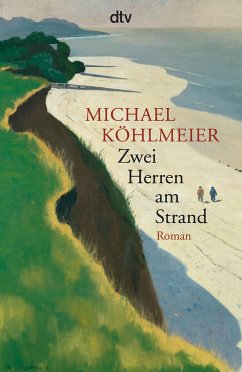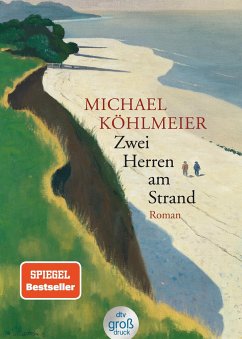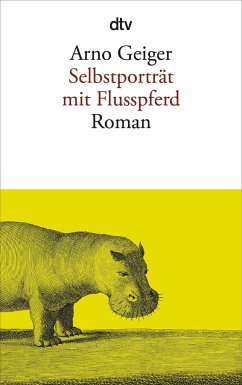Nicht lieferbar
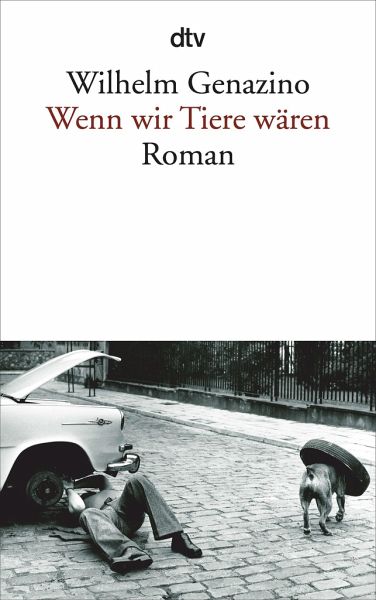
Wenn wir Tiere wären
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Brillante Beobachtungen aus dem Alltag
Die moderne Welt verlangt einfach zu viel vom Menschen, zumindest nach Meinung dieses Großstadtbewohners, dem das Talent zur Bewältigung seines Alltags vollkommen fehlt: die tägliche Anwesenheit am Arbeitsplatz, Engagement und freundliches Gesicht inklusive, der regelmäßige Besuch von Supermärkten, die routinierte Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Wilhelm Genazino erzählt von der tagtäglichen Überforderung und von einem Mann, der den Druck nur aushalten kann, indem er die Regeln bricht.
Die moderne Welt verlangt einfach zu viel vom Menschen, zumindest nach Meinung dieses Großstadtbewohners, dem das Talent zur Bewältigung seines Alltags vollkommen fehlt: die tägliche Anwesenheit am Arbeitsplatz, Engagement und freundliches Gesicht inklusive, der regelmäßige Besuch von Supermärkten, die routinierte Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Wilhelm Genazino erzählt von der tagtäglichen Überforderung und von einem Mann, der den Druck nur aushalten kann, indem er die Regeln bricht.