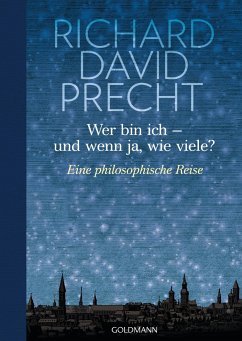Der Longseller als hochwertige Geschenkausgabe
Bücher über Philosophie gibt es viele. Aber Richard David Prechts Buch ist anders als alle anderen. Denn es gibt bisher keines, das den Leser so umfassend und kompetent - und unter Berücksichtigung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse - an die großen philosophischen Fragen des Lebens heran geführt hätte: Was ist Wahrheit? Woher weiß ich, wer ich bin? Was darf die Hirnforschung? Prechts Buch schlägt einen weiten Bogen über die verschiedenen Disziplinen und ist eine beispiellose Orientierungshilfe in der schier unüberschaubaren Fülle unseres Wissens vom Menschen: Eine Einladung, lustvoll und spielerisch nachzudenken - über das Abenteuer Leben und seine Möglichkeiten!
Hochwertige Geschenkausgabe in Halbleinen, mit farbigem Schnitt, Lesebändchen und vielen vierfarbigen Abbildungen.
Bücher über Philosophie gibt es viele. Aber Richard David Prechts Buch ist anders als alle anderen. Denn es gibt bisher keines, das den Leser so umfassend und kompetent - und unter Berücksichtigung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse - an die großen philosophischen Fragen des Lebens heran geführt hätte: Was ist Wahrheit? Woher weiß ich, wer ich bin? Was darf die Hirnforschung? Prechts Buch schlägt einen weiten Bogen über die verschiedenen Disziplinen und ist eine beispiellose Orientierungshilfe in der schier unüberschaubaren Fülle unseres Wissens vom Menschen: Eine Einladung, lustvoll und spielerisch nachzudenken - über das Abenteuer Leben und seine Möglichkeiten!
Hochwertige Geschenkausgabe in Halbleinen, mit farbigem Schnitt, Lesebändchen und vielen vierfarbigen Abbildungen.

Psychotests gibt es viele. Manche halten sogar wissenschaftlichen Ansprüchen stand. Andere sind nicht seriöser als Horoskope. Doch beliebt sind sie alle. Wir wollen schließlich wissen, wer wir sind.
Von Jörg Albrecht
Dass ein Sachbuch die Bestsellerliste des Spiegels erobert und sich dort mehr als vier Jahre lang auf Platz eins hält, kommt auch nicht alle Tage vor. Richard David Precht gelang das im Februar 2008. "Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?" hat sich seitdem mehr als eine Million Mal verkauft. Die Frage ist populär wie keine andere.
Bin ich ein Duckmäuser, ein Mitläufer, ein Fähnchen im Wind? Oder ein Narzisst, ein Machtmensch und Ehrgeizling? Jeder will wissen, was er und andere von ihm zu halten haben. Keine Frauenzeitschrift ohne Psychotest, der helfen soll, das herauszufinden. Und was am Ende herauskommt, stimmt ja irgendwie auch, hat man doch von jeher geahnt, dass man schüchtern ist und sein Licht viel zu oft unter den Scheffel stellt. Solche Tests sind wie Horoskope: Allgemeinmenschliches geht immer.
Ausgebildete Psychologen fühlen sich mit Recht auf den Schlips getreten, wenn man sie damit konfrontiert. Doch ihr Berufsstand kommt erst recht nicht ohne Fragebögen aus. In der Datenbank Psyndex werden für den deutschsprachigen Raum unter anderem aufgeführt: 3185 klinische Verfahren, 1828 Einstellungstests, 1370 Persönlichkeitstests, 682 Fähigkeits- und Eignungstests, 661 Entwicklungstests, 510 Intelligenztests samt Lernfähigkeits- und Gedächtnistests, 484 Schulleistungstests, 232 Verfahren zur Erfassung sensomotorischer Fähigkeiten, 228 Verhaltensskalen, 156 projektive Verfahren, 77 Interessen- sowie 24 Kreativitätstests.
Es fehlt demnach nicht an professionellen Bemühungen, Licht ins Dunkel der menschlichen Seele zu bringen. Es gibt sogar eine eigene DIN-Norm 33430, die regelt, welche Testverfahren bei beruflichen Vorstellungsgesprächen als seriös anzusehen sind. Denn mancher Personalchef vertraut im Zweifelsfall immer noch dem Gutachten eines Graphologen, der aus der Handschrift des Kandidaten auf dessen Charakter schließt.
"Gnothi seauton", erkenne dich selbst, heißt es seit dem Altertum. Hippokrates sah in sich und seinen Mitbürgern vier Temperamente am Werk: den Choleriker, der scharfsinnig, aber auch aufbrausend sei, den Melancholiker, den ein gesetztes Wesen, aber auch dauernde Missvergnügtheit kennzeichne, den Sanguiniker, der ein wenig einfältig, aber sorglos und gutmütig durchs Leben ginge, sowie den Phlegmatiker, der keine besonderen Charaktereigenschaften außer einer trägen Beharrlichkeit besitze. Die Lehre von den vier Temperamenten, denen die Körperflüssigkeiten gelbe und schwarze Galle, Blut und Schleim zugeordnet wurden, hielt sich bis in die Neuzeit; noch Immanuel Kant hat an sie geglaubt.
Persönlichkeitstests, wie wir sie heute kennen, wurden erst im zwanzigsten Jahrhundert entwickelt. Den Anfang machte die amerikanische Armee: Um jene Soldaten auszumustern, die besonders anfällig für den sogenannten Schützengrabenschock sein könnten, stellte der amerikanische Psychiater Robert Woodworth während des Ersten Weltkriegs einen hundert Punkte umfassenden Fragebogen zusammen, bei dem der Betreffende zum Beispiel angeben musste, ob er nachts häufiger aus dem Schlaf schrecke. Die Sache bekam eine solidere Basis, als sich Psychologen in den dreißiger Jahren daranmachten, die menschlichen Charaktereigenschaften systematisch zu erfassen. Sie durchforsteten Wörterbücher in der Annahme, dass die sprachliche Evolution im Laufe der Zeit genügend Ausdrücke hervorgebracht hätte, um jeden erdenklichen Wesenszug zu beschreiben. Tatsächlich fanden sich im Englischen rund 18 000 Begriffe. Fünf Prozent aller Wörter bezeichneten demnach irgendein Verhalten oder Naturell. Nachdem alle Synonyme aussortiert waren, blieben 4500 Ausdrücke übrig. Die wurden wiederum zu Wortgruppen zusammengefasst. Es blieben 16 Persönlichkeitstypen übrig.
Die Psychologen haben diese Typenvielfalt mit Hilfe von Befragungen und statistischen Methoden nach und nach auf fünf reduziert. Seit den achtziger Jahren nennt man sie die "Big Five" oder spricht vom "Ocean"-Modell, nach den Anfangsbuchstaben der fünf wesentlichen menschlichen Merkmale, als da sind: Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness und Neuroticism. Innerhalb dieses Spektrums, glauben heute viele Psychologen, lässt sich jede Persönlichkeit eindeutig, aber dennoch individuell beschreiben. Je nach dem Grad seiner Offenheit denkt und verhält sich ein Mensch konventionell oder originell, gibt sich vorsichtig oder wagemutig. Wie gewissenhaft er ist, zeigt sich darin, ob er sorglos oder umsichtig zu Werke geht. Das Merkmal Extraversion bezieht sich darauf, wie zurückgezogen oder wie gesellig ein Mensch lebt, wie gehemmt oder wie spontan. Verträglichkeit bezeichnet das Maß seiner Gereiztheit beziehungsweise Gutmütigkeit, seines selbstlosen oder egoistischen Verhaltens. Neurotizismus schließlich beschreibt die gegensätzlichen Merkmale Stabilität und Verletzbarkeit.
Die meisten Persönlichkeitstests, die auf diesem Modell beruhen, verlangen vom Probanden keine Selbsteinschätzung bezüglich der fünf Eigenschaften. Stattdessen wird er gefragt, in welchem Ausmaß er bestimmten Aussagen zustimmt. Auf das Merkmal Offenheit würde zum Beispiel die Behauptung "Ich probiere gern neue Speisen aus" zielen, auf das Merkmal Extraversion die Überzeugung "Ich mag die meisten Menschen, die ich treffe".
Fragebögen, die nach diesem Schema konstruiert sind, bezeichnen Psychologen als Persönlichkeitsinventare. Eines der am häufigsten benutzten ist das Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), das 1943 von dem amerikanischen Psychologen Starke Hathaway und dem Nervenarzt Charnley McKinley vorgestellt wurde und ursprünglich zur Diagnose psychischer Störungen gedacht war.
Das Minnesota-Inventar besteht aus mehr als fünfhundert Aussagen, die der Kandidat mit "stimmt", "stimmt nicht" oder "weiß nicht" bewerten kann. In der deutschen Ausgabe sind das Behauptungen wie "Ich werde leicht wütend, komme aber schnell wieder darüber hinweg". Oder: "Ich repariere gern ein Türschloss." Oder: "Der Mann sollte das Oberhaupt der Familie sein."
Bei der Auswertung werden die Antworten dann zu sogenannten Skalen zusammengefasst. Im Einzelnen geben die Skalenwerte an, wie stark jemand vom Durchschnitt abweicht. Erreicht er zum Beispiel beim Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit einen Wert von 2, so heißt das, dass 98 Prozent der getesteten Bevölkerung umgänglicher und mitfühlender sind als er; es wird sich also um einen ziemlich kritischen und kaltschnäuzigen Menschen handeln. Starke Abweichungen können im klinischen Zusammenhang auch auf eine psychopathologische Störung hinweisen. Die Güte solcher Tests lässt sich nach wissenschaftlichen Kriterien daran messen, wie valide, reliabel und objektiv sie sind. Ob sie also wiederholt dasselbe Ergebnis liefern, unabhängig vom Befragenden, und wirklich das erfassen, was sie zu erfassen vorgeben.
Anders verhält sich das mit Testverfahren, die in der Tradition Sigmund Freuds stehen und auf die Technik der freien Assoziation setzen. Am bekanntesten ist der Rorschach-Test, der von dem Schweizer Psychiater Hermann Rorschach in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelt wurde. Er besteht aus zehn Karten, auf denen jeweils ein Tintenklecks abgebildet ist. Der Analytiker zieht aus dem, was der Testkandidat darin erkennt, seine Schlüsse, und zwar nach einem System, das im Laufe der Zeit immer mehr verfeinert wurde. Besonders durchsichtig ist es nicht. Auf einem ähnlichen Prinzip beruht der Thematische Auffassungstest, bei dem es darum geht, eine bildlich dargestellte mehrdeutige Situation zu interpretieren.
Solchen "projektiven" Tests liegt die Annahme zugrunde, dass der Analysand seine Persönlichkeit unbewusst in das zu Deutende hineinprojiziert. So muss man wohl auch das Büroklammer-Orakel verstehen, das der Schweizer Psychiater Mario Gmür jetzt vorgelegt hat. Der Test sei, so sagt er, "nicht von letztem Ernst", aber das Ergebnis liege doch in vielen Fällen erstaunlich nahe bei der Wahrheit.
Gmür hat in seiner Praxis beobachtet, dass Patienten während des Gesprächs häufig in eine Schale mit Büroklammern auf dem Schreibtisch greifen und sie beiläufig verbiegen. Das sei, wie das Kritzeln beim Telefonieren, zunächst ein destruktiver Akt, dem ein kreativer Impuls folge, etwas halbwegs Sinnvolles daraus zu machen. Man könne das Resultat ähnlich deuten wie einen Traum.
Mario Gmür begann, die Biegearbeiten seiner Patienten zu sammeln. Der Fotograf Zoltan Gabor nahm sie vor weißem Hintergrund auf, eine kleine Ausstellung im Schaufester eines Zürcher Sportgeschäfts war die Folge. Das führte zur Anfrage des Verlags Kein & Aber, ob man daraus nicht ein Buch und einen Persönlichkeitstest machen könne. O nein, habe Gmür spontan reagiert, das sei doch Scharlatanerie, oder? Doch plötzlich, auf dem Rückweg vom Verlag, sei ihm eingefallen: Das ist ja noch besser als Rorschach!
Natürlich könne man an dieses Selbsterkennungsspiel nicht dieselben Gütekriterien anlegen, die bei naturwissenschaftlichen Tests gefordert werden, sagt Gmür. Er versteht sein Büroklammerexperiment eher als Protest gegen den Vermessungswahn in der Psychologie. Die Seele könne man sowieso nicht vermessen. Für klinische Fälle sei der Test nicht gedacht. Aber vielleicht nützlich bei der Berufs- und Eheberatung.
Und worauf beruhen nun die Charakter- und Typenbilder, die Mario Gmür so wortreich beschreibt? Da hält sich der Psychiater lieber bedeckt: "Der Zauberer verrät seine Tricks nie."
Eine Kurzform des Minnesota Multiphasic Personality Inventory findet sich unter http://de.outofservice.com/bigfive
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Denken musst du schon selber, rät Jens-Christian Rabe dem Leser. Nur wer das gegen die Suggestionskraft apodiktisch gefällter Urteile über Kant und Co zu beherzigen weiß, lässt Rabe uns wissen, dem wird das Buch zu etwas taugen. Rabe entlarvt den betont anti-akademischen Gestus, mit dem Richard David Precht in seiner philosophischen Propädeutik zu Werke geht, als "rücksichtslose Ranschmeiße", die mitunter in Bildungshuberei und "kreativer" Auslegung mündet. Andererseits staunt der Rezensent nicht schlecht, wie ein Buch mit immerhin 15 Seiten Literaturhinweisen, das die Komplexität der angerissenen Fragen dann doch nicht allzu sehr eindampft und sogar Fach-Diskussionen wiedergibt, zum Bestseller werden kann. Ist doch schön.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Wenn Sie dieses Buch lesen, haben Sie den ersten Schritt auf dem Weg zum Glück schon getan. [...] Dieses Buch ist unverzichtbar.« Elke Heidenreich
"extrem amüsant" und "ungemein aufschlußreich"