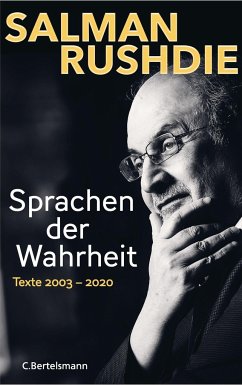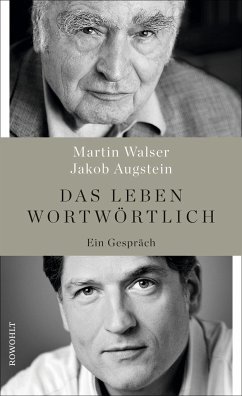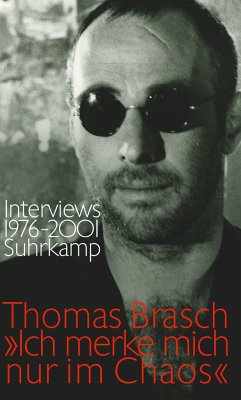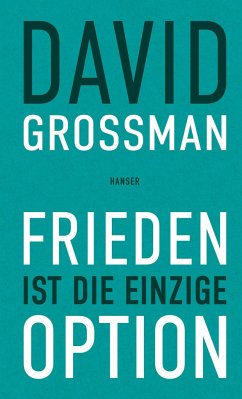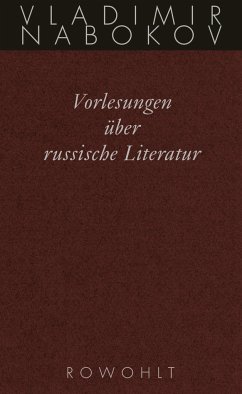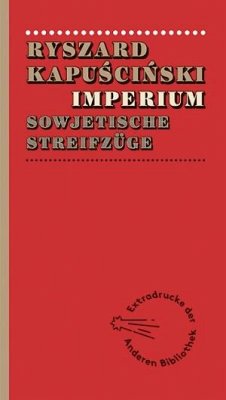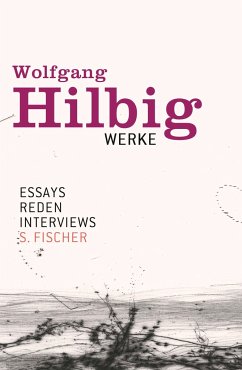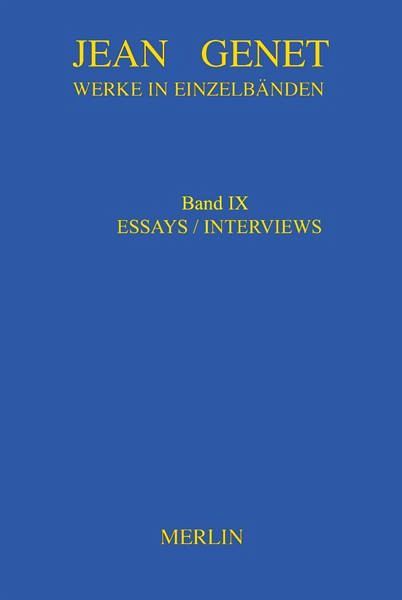
Werkausgabe. Werke in Einzelbänden - Essays & Interviews
Band IX
Übersetzung: Kayser, Christiane
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
32,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Artikel, Unterhaltungen, Vorworte und Reden - die hier zusammengetragenen Stellungnahmen und Positionierungen des Schriftstellers Jean Genet dokumentieren, dass Genet, obwohl er in seinen letzten zwanzig Lebensjahren sehr zurückgezogen lebte, in eindrucksvoller Weise in der Offentlichkeit prasent war. Von Chartres bis Chicago, von der Goutte d'or bis zu den Lagern von Sabra und Chatila, von den Ufern des Jordan bis in die Ghettos der African-Americans: Dieser Band der Werkausgabe ist das Protokoll eines literarischen und politischen Abenteurers, der sich an die Seite der Ausgestoßenen und Re...
Artikel, Unterhaltungen, Vorworte und Reden - die hier zusammengetragenen Stellungnahmen und Positionierungen des Schriftstellers Jean Genet dokumentieren, dass Genet, obwohl er in seinen letzten zwanzig Lebensjahren sehr zurückgezogen lebte, in eindrucksvoller Weise in der Offentlichkeit prasent war. Von Chartres bis Chicago, von der Goutte d'or bis zu den Lagern von Sabra und Chatila, von den Ufern des Jordan bis in die Ghettos der African-Americans: Dieser Band der Werkausgabe ist das Protokoll eines literarischen und politischen Abenteurers, der sich an die Seite der Ausgestoßenen und Revoltierenden dieser Welt stellte und für sich selbst nie einen anderen Titel beanspruchte als den des Vagabunden. Der Band enthalt weitgehend noch nicht auf Deutsch übersetzte und veroffentlichte Texte, u.a. Genets berühmte May Day Speech vom 1. Mai 1970 sowie den als Vorwort zu Texten der RAF verfassten Essay Gewalt und Brutalitat. Die beigefügte Kurzbiografie und die umfangreichen editorischen Anmerkungen des Herausgebers Albert Dichy (IMEC) liefern eine wertvolle literarische Einordnung der Texte in das Oeuvre des franzosischen Dichters und Dramatikers.