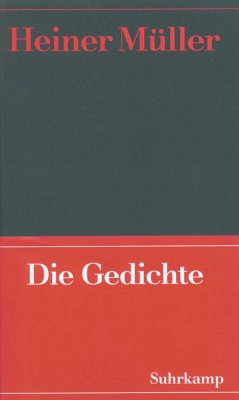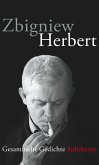Dieser Band I der Werkausgabe enthält neben allen Gedichten, die der Autor zu Lebzeiten in Büchern, Zeitschriften, Zeitungen und an entlegeneren Orten veröffentlichte, auch sämtliche 120 im persönlichen Archiv Heiner Müllers hinterlegten unveröffentlichten Gedichte. Erstmals wird hiermit das gesamte lyrische Schaffen des Autors im Zusammenhang vorgestellt. Heiner Müller hat an der Vorbereitung dieses Bandes noch selbst teilgenommen, Material gesichtet und geordnet. Es entspricht seinem Wunsch, daß diese Ausgabe dem Prinzip »brutaler Chronologie« folgt.
Bitte beachten Sie: Der Band enthält zwei Gedichte, die nicht von Heiner Müller, sondern von Günter Kunert stammen. Es handelt sich um die Texte »Impressionen am Meer« und »Die Uhr läuft ab«. Der Fehler wird in der nächsten Auflage des Bandes korrigiert.
Bitte beachten Sie: Der Band enthält zwei Gedichte, die nicht von Heiner Müller, sondern von Günter Kunert stammen. Es handelt sich um die Texte »Impressionen am Meer« und »Die Uhr läuft ab«. Der Fehler wird in der nächsten Auflage des Bandes korrigiert.

Heiner Müllers gesammelte Gedichte / Von Heinrich Detering
Am 30. Dezember 1995 ist Heiner Müller an Krebs gestorben. Am 12. Dezember hat er ein Gedicht geschrieben, das von diesem Vorgang handelt, genauer: von dem Tumor, dessen Leben ihn tötet. In den Augen der hilflosen Ärzte sieht der Kranke das eigene Sterben: "Beinahe rührte mich / Die Trauer der Experten und beinahe / War ich stolz auf meinen unbesiegten / Tumor / Einen Augenblick lang Fleisch / Von meinem Fleisch".
So hilflos und selbstbewußt, so traurig und ironisch - es gibt seit Heines Abschied nicht viele Texte in der deutschen Literatur, die sich diesen letzten Gedichten Heiner Müllers an die Seite stellen ließen. Hinter der Distanz des Beobachters gegenüber sich selbst, dieser unheimlichen Gelassenheit, ist eine leise und entschiedene Selbstbehauptung im wörtlichen Sinne am Werk. Sie läßt ihn nicht nur festhalten am Schreiben, sondern verlangt diesem Schreiben auch bis zum Schluß die äußerste Genauigkeit ab. Gegen sein eigenes Erlöschen mobilisiert Müller nicht die dokumentarische Notiz, sondern die Kunst. Rücksichts- und schonungslos reden diese Texte von dem, der sie aufschreibt, und sie sind dabei vollkommen frei von Larmoyanz und Exhibitionismus. Nicht Leben und Werk sind hier verschränkt, sondern Sterben und Schreiben.
Kurz zuvor ist dem Sterbenden die Handschrift unmöglich geworden. Schon dieses erste Beinahe-Verstummen aber widerlegt er, indem er es zum Gegenstand eines Gedichts macht. Die Hand, die sich sträuben will "gegen den Schreibzwang", wird unterworfen vom Kopf: "Nur die Schreibmaschine / Hält mich noch aus dem Abgrund dem Schweigen / Das der Protagonist meiner Zukunft ist". So zur Sprache gebracht, muß das Schweigen seinen Auftritt verschieben. Das "Ende der Handschrift" ist der Anfang des Textes; das Vorhandensein des Gedichts beweist, wovon es redet. Im Kontext von Schreibzwang und Kopf wird ein Wort wie "Schreibmaschine", die einfache Benennung eines Werkzeugs, ganz von selbst durchsichtig auf eine Tiefenschicht, in der es sich als autobiographische Metapher liest; das Pathos der Selbstbehauptung gegen den Tod ist gelöst, aufgelöst in ein ironisch verhangenes Bild.
Der verbreiteten Gewohnheit, handwerkliche Meisterschaft als Gegensatz zur Authentizität eines Dokuments zu begreifen, steht, nein: springt dieses Beharren auf Formbeherrschung entgegen. Der Todkranke demonstriert eine souveräne Verknappung der Kunstmittel - in der diskreten Rhythmisierung der prosaischen Sätze, in der Präzision der Bilderfügung, am Ende im Zitatenspiel mit Klopstocks "mutter natur" und der "anatomie des dr. benn". Aus großer Entfernung auf sich selbst blickend, stellt er eine diskrete Intimität her, die auch dem Leser Distanz erlaubt.
Heiner Müllers gesammelte Gedichte umfassen einen Zeitraum von mehr als vierzig Jahren. Von ihrem Ende her betrachtet, lesen sie sich wie das Protokoll einer Verdunkelung, bis zum vorletzten Augenblick. Am Ende, zwischen den Bruchstücken des letzten Gedichts, wird dann die Dunkelheit sichtbar als das sich ausbreitende Weiß des unbedruckten Papiers. Der so endende Band eröffnet eine siebenbändig geplante Werkausgabe. Er umfaßt rund 250 Gedichte, von denen 121 hier zum ersten Mal veröffentlicht werden, dazu viele weitere, die seit ihrer Erstveröffentlichung in Vergessenheit geraten sind. Der philologische Brauch, Werkausgaben mit Gedichten zu eröffnen, hat hier eine glückliche Nebenwirkung: Er rückt ein Textcorpus ins Licht, das bisher eher ein dauerhafter Geheimtip war - trotz Müllers eigener schmaler Auswahlausgabe von 1992, auch trotz des großen Gedichts "Mommsens Block" im Jahr darauf. Daß der Dramatiker Müller, wie sein Vorgänger und Antipode Brecht, auch ein Lyriker von Rang gewesen ist, hat sich noch immer nicht weit genug herumgesprochen. Das kann, das wird sich jetzt ändern.
Das Ich, das sich in Müllers letzten Gedichten so entschieden behauptet, hat eine bewegte Vorgeschichte. In deren früheren Abschnitten war es kaum zu sehen vor lauter Ichs, verlor sich seine Stimme im Gestrüpp der Schriften. Was hier unter dem Autornamen Heiner Müller versammelt ist, erfüllt über lange Wegstrecken den Tatbestand eines pluralen Subjekts so genau, als gelte es die Verwirklichung eines postmodernen Programms. Mitten in den fünfziger Jahren, als die nachmals florierende Rede von der Intertextualität noch gar nicht eingesetzt hat, überkommt den Schreibenden "endlich die Wahrheit Daß du nur ein Zitat bist / Aus einem Buch das du nicht geschrieben hast / Dagegen kannst du lange anschreiben auf dein / Ausbleichendes Farbband Der Text schlägt durch". Das frappierendste an diesen Versen ist der Umstand, daß sie sehr genau beschreiben, was in der chronologischen Folge der Gedichte zur Anschauung kommt. Überall schlagen hier, ganz buchstäblich, Texte durch. Unmittelbar augen- und ohrenfällig wird das in der Fülle der Ausdrucksmittel. Müller schreibt freie Verse und Sonette, Hexameter und Distichen, Blankverse und Volkslieder, Haikus und Kinderreime; Balladen und Romanzen, Agitprop und Tagebuch.
Namhaft gemacht wird diese Polyphonie in den vielen Hinweisen auf Vorlagen, Anregungen und Antipoden. Die Gedichte stellen sich vor als Bearbeitungen "nach Defoe", nach alten und neuen chinesischen Gedichten, nach Dante und Anna Seghers, Goethe und Euripides, paraphrasieren antike Mythen und östliche Spruchdichtung und immer wieder Shakespeare - tatsächlich geht sein Weg lange Zeit, wie er in den siebziger Jahren notiert, "from Stratford to Stratford", von Hamlet und Lear in den frühen Texten bis zu einem "Sturm"-Zitat im allerletzten Gedicht. Hölderlin wird nie genannt, aber seine Syntax ist eines der Muster, die sich am deutlichsten bemerkbar machen: "Eher den Schlag vergißt / als den Schläger der Geschlagene". Schon früh sind unter den zitierten Texten auch die eigenen, zunächst und vor allem die Dramen. Von "Mauser" bis zur "Hamletmaschine", vom "Medeaspiel" zu "Ödipuskommentar" und "Elektratext": immer wieder werden in den Gedichten Dramenprojekte mehr oder minder explizit verhandelt, in Gestalt von Entwürfen, Kommentaren, Seitenstücken. "Ich lese", notiert Müller 1975, "was ich vor drei, fünf, zwanzig Jahren geschrieben habe, wie den Text eines toten Autors."
Dieses Bekenntnis zur Selbstdistanz benennt auch ein Schreibverfahren. Der fremde Blick auf das eigene Material, die Zunahme der Selbstzitate trägt dazu bei, daß sich das lyrische Konvolut als ein durchlaufendes work in progress liest, als Heinertext und Müllerspiel. Motivechos antworten einander über weite Abstände; ein Vers wird in unterschiedlichen Kontexten erprobt. So heterogen die lyrischen Formen sich präsentieren, so homogen ist das Ganze als eine Collage aus eigenen und fremden Texten. Der Postmoderne, zu deren Protagonisten Müller am Ende selbst gehört hat, war er schon zu seinen parteifrömmsten Frühzeiten manchmal näher, als es der Partei lieb sein mußte.
Wenn es dennoch schon von Beginn an eine Stimme gibt, die diese widerstrebenden Tendenzen zusammenhält, dann ist es die Lyrik Brechts. Müllers frühe Gedichte bewegen sich ihr gegenüber zuweilen hart am Rande des Epigonalen. Auf den berühmten "Hauspostille"-Vers "Ihr sterbt mit allen Tieren / Und es kommt nichts nachher" antwortet hier ein Weihnachtsgedicht: "Es blieb die Welt beim alten, / und es kam nichts danach", auf den Refrain des "Schneiders von Ulm" ("Der Mensch ist kein Vogel / Es wird nie ein Mensch fliegen") die ironische Lehre: "Tausend Jahre lang galt es für ausgemacht, / Vögel und Engel können fliegen, der Mensch / Kann nicht fliegen." Doch nicht nur Brechts didaktische Posen werden fortgeschrieben, sondern auch seine unartigen erotischen Sonette und die frech ideologiekritischen Kommentare zum klassischen Kanon. Müller setzt Brechts chinesische und altdeutsche Masken auf und bewegt sich in seinen Stilfiguren: des zeigenden Redens ("Ich sage . . .") und der Kombination von argumentativem Partizipialstil und Enjambements ("redend / in menschlicher Zunge"). So adaptiert er Brechts Verbindung von Sinnlichkeit und Sachlichkeit, macht sich dessen nüchterne Musikalität zu eigen, erlernt die Anmut der Vernunft. Brecht hat Vorschläge gemacht, Müller hat sie angenommen, und er hat sie weitergedacht. Brechts Lyrik ist der Sauerteig dieser Gedichte - läßt sie aufgehen, bestimmt ihr Aroma und macht sie haltbar.
Der genau entgegengesetzte Fall der Übernahme fremden Textmaterials sind Müllers Übersetzungen sowjetischer und anderer Parteilyrik der fünfziger Jahre. Das war, wie er selbst immer wieder betont hat, Brotarbeit; aber gerade darum werden diese Unterwerfungsgesten hier mit Recht in Lebensgröße dokumentiert. Neben dem obligatorischen "Gruß an Korea" stehen da ein "Lied über Stalin", ein "Lied von Stalin" und andere Lieder, in denen der teure Name leuchtet. Zuweilen wird da das stereotype Pathos der Vorlagen vom Nachdichter Müller dermaßen konsequent verdeutscht, daß man argwöhnt, die Komik sei nicht gänzlich unfreiwillig. Was geht beispielsweise einem Arbeiter in Lahore durch den Sinn, wenn er an nackter Hüttenwand Stalins Bild erblickt? Dies: "Seinen Stern auf unsre Fahne! / Und wo Schatten war, wird Licht! / Also sprach der Pakistane - / Staub und Striemen im Gesicht." Schöner kann man es nicht sagen. Die Szene stammt von Nikolaj Tichonow; der Reim "Fahne - Pakistane" aber ist Müllers zweideutige Zutat. Auch der "Sowjetmensch, grade und schlicht", ist unvergeßlich, von dem der Dichter weiß: "Sowjetische Geigen erringen / den höchsten, den würdigsten Preis." Freilich - der Sowjethimmel, der da voller Geigen hängt, ist nur ein übersetzter. Das ironiefreie "Lenin-Lied" hingegen, das im März 1970 im "Neuen Deutschland" stand, geht auf Müllers eigene Rechnung: "Das Recht ist Pflicht und Pflicht ist Recht / In unsrer Republik."
Als aber der aus Partei und Schriftstellerverband ausgeschlossene Dichter sich mit vorschriftsmäßig gebellten Versen als braver Kettenhund ausgab, da lag sein Gedicht "Für W. Biermann" schon seit zehn Jahren in der Schublade. Derselbe lyrische Aktivist, der in einem biederen "Traktoristenlied" Panzer zu Traktoren umschmiedet und "Stalingrad" auf "Frühlingssaat" reimt, nimmt wenig später Walter Strankas Planerfüllungslied "Fritz, der Traktorist" satirisch aufs Korn. Und viel früher schon hatte der Riß, der hier zwischen den Textgruppen verläuft, einzelne Gedichte gespalten. Schon in den fünfziger Jahren hatte Müller auf die Kunstreligion Rilkes die kommunistische Zukunft antworten lassen: "Denn das Schöne bedeutet das mögliche Ende der Schrecken." Das Schöne: das sind beispielsweise die Hochöfen und Kraftwerke im Kombinat "Schwarze Pumpe", deren Lärm und Staub der menschenfernen "Schönheit der Landschaft" gegenübergestellt sind; und diese Provokation bleibt so gefällig wie zeitgemäß. Ganz anders hingegen die Utopie des Kommunismus, die im selben Zusammenhang fast nebenbei entworfen wird als "das Endbild, das immer erfrischte / Weil mit Blut gewaschen wieder und wieder". Das ist in der Spannung zwischen zynischem Einverständnis mit dem Terror und seiner bösen Benennung ein Ton, der in dieser Frühzeit noch verwirrend klingt. Nicht mehr lange, und er wird unüberhörbar.
Vor allem die Erinnerung an die halb forcierte, halb traurig-resignative Gewaltbereitschaft der antifaschistischen Kampfzeit wird in den späteren Gedichten zu einem zentralen Thema. Was in einem Nekrolog auf Che Guevara zu lernen war, wurde kurz darauf "Zur Ermordung Martin Luther Kings" in einem leisen und harten Vers resümiert: "Gegen Gewalt hilft Gewalt, sagt sein Schweigen." In einer Nachdichtung chinesischer Verse hatte derselbe Grundsatz gelautet: "Das Gute wird nicht erreicht durch / Güte". Und hier wie dort umschrieben diese Sätze in Wahrheit jene berühmten Verse des exilierten Brecht an die Nachgeborenen, die Müller erst im Todesjahr der DDR wörtlich zitiert:
Wir die den Boden bereiten wollten
für Freundlichkeit
Wieviel Erde werden wir fressen
müssen
Mit dem Blutgeschmack unserer Opfer
Im selben Zyklus dann, wenige Verse später, der Abschied von der einen Wahrheit und der Blick auf das Grab:
Meine Herausgeber wühlen in alten
Texten
Manchmal wenn ich sie lese überläuft
es mich kalt Das
Habe ich geschrieben im Besitz der
Wahrheit
Sechzig Jahre vor meinem mutmaßlichen
Tod
Auf dem Bildschirm sehe ich meine
Landsleute
Mit Händen und Füßen abstimmen
gegen die Wahrheit
Die vor vierzig Jahren mein Besitz war
Welches Grab schützt mich vor meiner
Jugend
Ausgerechnet der uralte Ernst Jünger hat diese Verse in einem seiner letzten Fernsehinterviews zitiert mit der Bemerkung: "Das ist gut, oder?" Wenige wußten so gut wie er, wovon Müller da sprach. Die Scham, nicht der Besitz der Wahrheit, wurde jetzt zur Triebfeder des Schreibens: "Meine Scham braucht mein Gedicht." Dabei gehörte der späte, skeptische Jünger selbst zu den Autoren, die jetzt im Müllerschen Zitatenkosmos auftauchen. Im Jahr 1989 widmet er Honecker ein Gedicht, das selbstironisch Ezra Pound paraphrasiert; und vier Jahre später, im großen Gedicht "Mommsens Block", nennt er diesen Bewunderer Mussolinis den "andren Vergil / Der auf den falschen Cäsar gesetzt hat gescheitert auch er". Unter den "Lügen der Dichter", die Müller aufgebraucht sah "vom Grauen des Jahrhunderts", waren auch seine eigenen; und in den eigenen Lügen erkannte er die des Jahrhunderts, der Jahrhunderte wieder. Sein Blick wandert zurück in die Anfänge der Moderne, die Renaissance, die antiken Muster. Jetzt beschäftigt ihn "Senecas Tod", jetzt stiftet er nicht mehr ganz unerwartete Allianzen ("marx kuesst nietzsche"), und "im weißen Rauschen / Kehren die Götter zurück nach Sendeschluß".
Die Wiederkehr des Mythos aber hält keinen Trost bereit, sondern erleichtert bloß die Beschreibung der Trostlosigkeit. Benjamins "Angelus Novus", den ein früher Text noch in einen angestrengten Optimismus umgedeutet hatte, mutiert in einem späten zum "Engel der Verzweiflung". Prometheus erscheint als Bruder Stalins im Hoffen auf den neuen Menschen, dessen Vorbedingung "die vernichtung / des alten war", und auf beide läßt Müller nun Lenins Satz antworten: "wir haben / den galgen verdient". Das Scheitern der Cäsaren beschreibt er als das ihrer Apologeten, ihrer Wahrheiten und Avantgarde-Ansprüche.
Hinter den untergehenden Wahrheiten tauchen sehr alte Bestände wieder auf. Schon zwischen den ersten Rissen und Brüchen der ideologischen Gewißheiten, im Nachlaß der fünfziger Jahre, wird Vanitas-Metaphorik sichtbar; halb noch Brecht, halb schon Barock. Über den Schnee, der auf der Haut schmilzt, schreibt Müller da die emblematischen Verse: "So spürst du doch an ihm, daß es ihn gibt und / Wie sehr er flüchtig ist und muß verziehn. / Er wird schon Wasser, wenn du ihn gespürt hast. / Aber für eine Weile spürst du ihn." Lange nach diesen schön gereimten Blankversen, ein Jahr vor seinem Tod, wird er zurückblicken auf das "Schreibglück der fünfziger Jahre / Als man aufgehoben war im Blankvers", und dann wird er für die Beschreibung des Ausgesetztseins rauhere Töne gebrauchen. Aber die emblematische Verbindung des Alltäglichen mit der Idee von Dasein und Vergehen bleibt dieselbe, tritt nur nackter und härter hervor: "Zahnfäule in Paris. / Etwas frißt an mir // Ich rauche zu viel / Ich trinke zu viel // Ich sterbe zu langsam".
Die Pose des coolen Zynikers, für die Müller soviel bewundert und gescholten worden ist, gibt sich vor diesem Horizont als Sicherheitsvorkehrung gegen Sentimentalitäten zu erkennen. Was sie hier ermöglicht, sind vor allem sehr schöne und traurige Verse - zart, genau, in einer vollkommen sicheren Balance von Erregung und Gelassenheit. Nicht daß nicht auch hier manche Metaphern in flachen Klischees landeten wie dem vom Zerbrechen der Masken vor dem Spiegel oder dem Verbrennen des Schattens in der Sonne. Aber unter den oft ganz kurzen Gedichten, die der Schreiber jetzt - "Zeit ist Frist" - mit genauen Datumsangaben zu versehen beginnt, sind Verse, die allein genügen würden, diesen Dichter unvergeßlich zu machen - über die Kindheit und das "Glück das Angst", über Sterben und Vergessen, über den Einbruch der Nacht.
Wenn in dieser Koinzidenz des eigenen Sterbens mit dem Siechtum einer Utopie und dem Ende einer Epoche ein Zynismus liegt, dann ist es derjenige der Geschichte, den der Dichter nur beschreibt. Nicht von ungefähr hat Müller seine eigene Gedichtsammlung mit dem Jahr 1949 einsetzen lassen, dem Geburtsjahr jener Republik, nach deren Ende er die Gedichte zu sammeln begann. Nicht nur um diesen Staat ging es da, aber Hoffnung und Enttäuschung, Lüge und Scham wurden verhandelt an seinem konkreten Fall. Nicht anders wird auch das Sterben des Dichters, indem es als die eine, unaustauschbare Geschichte genau erzählt wird, exemplarisch.
Das führt die vorliegende Ausgabe in ihrer von Müller erwünschten "brutalen Chronologie" vor, und deshalb ist es gut, daß es sie gibt. Zu bedauern ist freilich, daß sie fast völlig auf Kommentare verzichtet, also beispielsweise weder Herkunft noch Beschaffenheit der Vorlagen für Müllers Bearbeitungen und Nachdichtungen erläutert. So bleibt, wer sich nicht schon vorher mit P'u Sung-ling oder Po Chü-i auskannte, über Müllers Umgang mit deren Texten auf Vermutungen angewiesen. Die oft bewußt vagen Angaben zu Entstehungsumständen und -daten seiner Gedichte, mit denen der Dichter Neugierige abspeiste, werden lediglich mit dem Hinweis auf ebendiese Vagheit übernommen; es bleibt also auch hier, wie in Müllers eigener Auswahl von 1992, bei der groben Gliederung nach Dekaden von "1949 . . ." bis "1989 . . .". Das führt zu einer eigentümlich schiefen Quellenlage: Während die zunächst einzeln in Zeitschriften, Zeitungen oder Anthologien veröffentlichten Gedichte hier eben in der Fassung jener Entstehungszeit abgedruckt werden, folgt ein großer Teil der übrigen Texte der Müllerschen Auswahl und läßt damit offen, ob es der Leser tatsächlich mit dem Wortlaut von Gedichten der fünfziger, sechziger oder siebziger Jahre zu tun hat, mit deren späteren Überarbeitungen oder womöglich gar mit Neufassungen. Der "zu erwartenden Kritk an dieser eingestandenen editorischen Begrenztheit" beugt der Herausgeber mit dem Hinweis auf die Vorläufigkeit seines Unternehmens vor. Das muß man hinnehmen. Nicht hinnehmen sollte man hingegen manche waghalsigen Formulierungen des Nachworts, das anstelle eines Kommentars Mutmaßungen über Müllers Auflösung einer "linearen Kausalität" anstellt und beiläufig so sonderbare Differenzierungen voraussetzt wie die zwischen "sowohl Form als auch struktureller Gestalt" der Edition. Deren großes Verdienst aber, Müllers Gedichte überhaupt so umfangreich zugänglich zu machen, wird von derlei Vagheiten nicht berührt. Die Gedichte sind da, das ist die Hauptsache, anrührende und aufregende Kunstwerke, Protokolle der Verdunkelung. Man sollte sie lesen, solange noch Licht ist.
Heiner Müller: "Die Gedichte".Werke, Band 1.Herausgegeben von Frank Hörnigk. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998. 359 S., geb., 44,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main