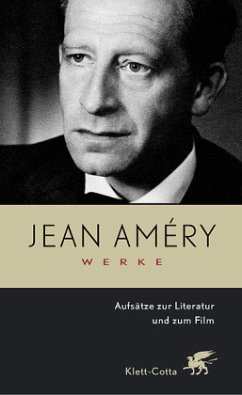"Aufklärung ist - das immerwährende erhellende Gespräch, das wir mit uns selbst und mit dem anderen zu führen gehalten sind." Jean Améry
Jean Améry zählt zu den bedeutendsten europäischen Schriftstellern und Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Seine bahnbrechenden Essays sind in ihrer Bedeutung wohl nur mit den Schriften Hannah Arendts und Theodor W. Adornos zu vergleichen. Améry hat wie kein anderer die deutsche Öffentlichkeit mit französischen Dichtern und Denkern wie Proust und Flaubert, Sartre und Simone de Beauvoir bekannt gemacht.
Diese große neue Edition der Werke Amérys gibt zum ersten Mal einen Gesamtüberblick über die Vielseitigkeit dieses europäischen Denkers. Die auf neun Bände angelegte Ausgabe stellt den Kulturkritiker wie den Romancier vor, zum Teil mit noch nie erschienenen Texten. Jeder Band enthält einen Dokumentationsteil und ein eingehendes Nachwort zur Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte der jeweiligen Texte.
Einen zentralen Teil der Ausgabe bilden die drei Aufsatzbände. Zunächst erscheint Band 5 - er sammelt Amérys Arbeiten zur Literatur und zum Film. Amérys Literaturessays repräsentieren eine faszinierende Form gelebten Lesens. Die Texte dieses Bandes, deren Spektrum von Georges Bataille bis Michel Tournier, von Thomas Mann bis Thomas Bernhard reicht, machen Literatur als existentielle Erfahrung nachvollziehbar. Gleiches gilt für die Filmkritiken, die in diesen Band aufgenommen wurden.
Jean Améry zählt zu den bedeutendsten europäischen Schriftstellern und Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Seine bahnbrechenden Essays sind in ihrer Bedeutung wohl nur mit den Schriften Hannah Arendts und Theodor W. Adornos zu vergleichen. Améry hat wie kein anderer die deutsche Öffentlichkeit mit französischen Dichtern und Denkern wie Proust und Flaubert, Sartre und Simone de Beauvoir bekannt gemacht.
Diese große neue Edition der Werke Amérys gibt zum ersten Mal einen Gesamtüberblick über die Vielseitigkeit dieses europäischen Denkers. Die auf neun Bände angelegte Ausgabe stellt den Kulturkritiker wie den Romancier vor, zum Teil mit noch nie erschienenen Texten. Jeder Band enthält einen Dokumentationsteil und ein eingehendes Nachwort zur Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte der jeweiligen Texte.
Einen zentralen Teil der Ausgabe bilden die drei Aufsatzbände. Zunächst erscheint Band 5 - er sammelt Amérys Arbeiten zur Literatur und zum Film. Amérys Literaturessays repräsentieren eine faszinierende Form gelebten Lesens. Die Texte dieses Bandes, deren Spektrum von Georges Bataille bis Michel Tournier, von Thomas Mann bis Thomas Bernhard reicht, machen Literatur als existentielle Erfahrung nachvollziehbar. Gleiches gilt für die Filmkritiken, die in diesen Band aufgenommen wurden.

Expeditionen ins Denkreich: Die beiden ersten Bände der Werkausgabe Jean Amérys / Von Henning Ritter
In den späten sechziger und in den siebziger Jahren gehörte Jean Améry zu den wenigen Schriftstellern in Deutschland, die eine unangefochtene persönliche Autorität besaßen. Er hatte sein Schicksal nicht moralisierend beschworen, sondern in "Jenseits von Schuld und Sühne" in einem kurzen Kapitel - "Die Tortur" - in einer ungeheuer eindringlichen Weise beschrieben. Die Erfahrung der Folter, das ergab sich aus diesen wenigen Seiten, war für Jean Améry zur Erfahrung schlechthin geworden. Die Folter war, indem sie alles Bewußtsein in den Körper auflöste, eine Auskunft über die Existenz. Diese Seiten teilten über den Autor kaum mehr mit, als daß sein Leben durch diese Erfahrung absolut bestimmt sei. Er nahm nichts weiter für sich in Anspruch als die Authentizität seines Berichts über die Folter und den Weg nach Auschwitz, Buchenwald und Bergen-Belsen, wo er im April 1945 befreit worden war.
Der zunächst unter dem Titel "Ressentiments. Bewältigungsversuche eines Überwältigten" angekündigte Essayband "Jenseits von Schuld und Sühne", der 1966 erschien, war das erste Werk des vierundfünfzigjährigen Autors, der im übrigen ein vielbeschäftigter Verfasser von Rundfunksendungen und Buchbesprechungen war. Seit 1965 publizierte er in Hans Paeschkes "Merkur", es wurden, bis zu seinem Selbstmord 1978, rund sechzig Essays, Glossen, Rezensionen. Auftritte in Werner Höfers "Internationalem Frühschoppen", in Akademien und bei Diskussionen kamen hinzu.
Jean Améry beeindruckte durch seine lakonische Sprache, vor allem aber dadurch, daß er mit keiner der gängigen intellektuellen Moden paktierte. Sartre, dem er sich aus der Distanz wie einem Lehrer verbunden fühlte, war damals schon nicht mehr die allgegenwärtige Gestalt, die er in den ersten Nachkriegsjahren gewesen war. Dem Leser seiner Essays konnte nicht verborgen bleiben, daß die sehr entschiedenen Ansichten ihres Verfassers sich nicht der Kommunikation verdankten.
Das Moralisieren war Amérys Sache nicht, er appellierte nicht, sondern er stellte fest. Ihm fehlte durchaus die Beziehung zu dem, was gewöhnlich als Moral bezeichnet wird. Sein Billigen wie sein Verurteilen hatten Gründe, die außerhalb der Zuständigkeit des Gedankenaustauschs lagen. Sie hingen letztlich mit der Erfahrung zusammen, die er in dem erwähnten Kapitel geschildert hat: Er war dem Bösen begegnet und war sich dessen gewiß, es jederzeit erkennen und bezeichnen zu können. Die Eindeutigkeit seiner Erfahrung war nicht zu erschüttern oder zu überbieten.
Mit dieser Gewißheit der Bundesrepublik sich zu nähern mußte zu Schwierigkeiten führen - zunächst zu eigenen Schwierigkeiten, dann aber auch im Sichhineindenken in ein Land, das sich, anders als Jean Améry, von den Schrecken der Vergangenheit in einem beispiellosen Tempo zu lösen schien. In seinem 1971 erschienenen schmalen Buch mit dem wunderschönen Titel "Unmeisterliche Wanderjahre" hat Jean Améry nicht nur die ersten Schocks seiner Begegnung mit Deutschland, sondern die anhaltenden Verwirrungen geschildert, in die es ihn stürzte und die auch der studentische Aufbruch der sechziger Jahre und die neue Linke bei ihm nicht zu beschwichtigen vermochten. Von dem, was sich nun theoriegestützt als Antifaschismus gerierte, war Jean Améry nicht zu beeindrucken, geschweige denn zu integrieren. Er blieb der Außenseiter auch der Theorien, die eben das Grauen zu denken versuchten, das er erfahren hatte.
Jean Améry hat die Schilderung seiner Expedition in die neue linke Welt mit Zügen eines Schelmenromans versehen, dessen Held aus dem Staunen nicht herauskommt und sich am Ende zurückzieht - "so lernte er bei den Expeditionen neben dem Gruseln auch die Bescheidenheit. Am besten war es, sich stille zu verhalten, nicht aufzufallen." Mit diesem Fazit endet ein Abschnitt über den erstaunlichen Erfolg Adornos bei der heranwachsenden Generation: "Die realen Greuel", schreibt Améry, "bei denen sich niemand aufzuhalten brauchte, wenn in angestrengter Begriffssprache doziert wurde, bekamen etwas Märchenhaftes, Greuelmärchen. Die abstrakte Reflexion nahm ihnen ihre Schrecken . . . In den Seminaren wurde der Schrecken transsubstantialisiert." Adorno warf er vor, "den heraufrückenden Generationen Intellektueller nebst dem schneidenden Vokabular auch das fleckenreine linke Gewissen" zu verschaffen.
An Äußerungen wie diesen wird deutlich, was Ressentiment vermag. Améry hielt unerbittlich an seiner Erfahrung des Bösen fest, so entschieden, daß er jedes Bündnis mit der Reflexion sich untersagte. Die Philosophie war ihm im Lager vergangen. Es blieb ein Positivismus des Leidens. Dieser unerbittliche Tatbestand ging in seine Beschreibungen des Landes ein, in das er nur noch berufliche Expeditionen machte. Amérys Ressentiment war um so leichter zu erkennen, als er sich zu ihm als Medium seiner Wahrnehmung bekannte. Der Purismus der Erfahrung macht stumm, aber das Ressentiment belebt. Eines Tages wird man die Beobachtungen, die Jean Améry über die Bundesrepublik machte, als ein Kapitel aus dem "Candide" unserer Zeit lesen, die Schilderung eines Landes, in dem die Menschen aufgehört hatten, das Böse wahrzunehmen.
Wie wenige sonst hat Jean Améry das Schicksal des Überlebenden sichtbar gemacht: "Für mich heißt Jude sein die Tragödie von gestern in sich lasten spüren." Als junger Mann war er sich seines Judentums erst bewußt geworden durch die Feinderklärung der Nationalsozialisten, und an dieser Identität hat er auch danach unerbittlich festgehalten. Mit dem Judentum verband ihn darüber hinaus wenig, sein Gefühl der Zugehörigkeit kam aus der gemeinsamen Verfolgung, wie er mit brutaler Offenheit ausgesprochen hat: "Ich trage auf meinem linken Unterarm die Auschwitz-Nummer; die liest sich kürzer als der Pentateuch oder der Talmud und gibt doch gründlicher Auskunft." Dies war eine unangreifbare Position, aber sie bedeutete auch, daß Jean Améry als Teil eines kollektiven Gedenkens nicht taugte. Unter den namhaften Zeugen des Holocaust dürfte er einer der einsamsten sein. Seine Berichte über die Folter und die Lager, denen er knapp entronnen war, sind erschütternd auch durch die radikale Verweigerung jeden Trostes. Vielleicht liegt hier auch die Erklärung dafür, daß es um Jean Améry vergleichsweise still geworden ist.
Daß sein Verlag nun begonnen hat, eine Werkausgabe auf den Weg zu bringen, ist verdienstvoll. Die beiden bisher erschienenen Bände (von neun geplanten) enthalten die wichtigsten essayistischen Schriften Jean Amérys - "Jenseits von Schuld und Sühne", "Unmeisterliche Wanderjahre", "Örtlichkeiten" - und Buchbesprechungen und Filmkritiken. Im Lauf der Jahre wurde er ein vielbeschäftigter und angesehener Rezensent und Essayist. Ein Teil seiner Produktion wurde nur im Radio gesendet und ist nie gesammelt worden. All dies nachzulesen hat gewiß seinen Wert. Ob man daraus allerdings einen Gegenstand eingehenden Studiums machen sollte, ist zu fragen. Der zweite Band der Werkausgabe enthält einen Anhang von 360 Seiten mit Dokumenten und Interpretation, beim fünften Band sind es siebzig Seiten. In beiden Fällen gilt die editorische Anstrengung dem Versuch, die "Rezeption" Amérys nachzuzeichnen.
So enthält der zweite Band auch den Erstdruck eines Manuskriptes "Zur Psychologie des deutschen Volkes", das als Zeugnis der ersten Gedanken, die sich Jean Améry über die in seinen Augen wünschenswerte Zukunft machte, aufschlußreich ist. Aber schwieriger ist es, den Text überhaupt richtig einzuschätzen, es sei denn als Vorstufe zu "Jenseits von Schuld und Sühne". Er ist nur aus der Situation einer anderen Stunde Null zu verstehen. So fordert er nicht nur die "integrale physische Extermination von sämtlichen führenden Parteipersönlichkeiten", sondern sieht es auch als unbedenklich an, wenn dieses "generelle Vorgehen" auch Leute betreffen würde, denen individuell keine Verbrechen nachzuweisen wären, "denn es handelt sich auch bei ihnen um Menschen, deren Erziehung jederlei Abwegigkeiten erwarten läßt". Aus ähnlichem Furor entsprang auch seine Idee, Nietzsche, Klages, Spengler "nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern" verbieten zu lassen.
Wer sich die äußeren und inneren Schwierigkeiten vergegenwärtigt, die Jean Améry überwinden mußte, um als freier Journalist sein Auskommen zu finden und sich darüber hinaus von seinen Brotarbeiten zu befreien und Schriftsteller zu werden, wird mit Bedauern bemerken, wie ein Werk, dessen schmaler Umfang seine Physiognomie ausmacht, mit Dokumenten, Beilagen und Deutungen überladen wird. Die Vorstellung, in einen Seminardiskurs, gegen den er eine so deutliche Antipathie bekundet hat, integriert zu werden, hätte diesem Autor gewiß nicht behagt.
Zu dem komplizierten Verhältnis Adornos zu Améry stellt Gerhard Scheit in seinem Nachwort fest, daß die Spuren von dessen Auseinandersetzung mit dem Tortur-Essay in der abschließenden Fassung der "Negativen Dialektik" sich verloren hätten - für den Preis des vollen Bewußtseins, "daß die extreme Spannung zwischen dem Subjektiven und dem Allgemeinen sich nicht nach einer Seite hin auflösen läßt". Eben darin, so das Fazit, wäre "die Kritik der metaphysischen Philosophie zu formulieren". Nichts lag Jean Améry ferner als ein solches Vorhaben.
Jean Améry: "Aufsätze zur Literatur und zum Film". Werke. Band 5. Herausgegeben von Hans Höller. 640 S., geb., 34,- [Euro].
Jean Améry: "Jenseits von Schuld und Sühne. Unmeisterliche Wanderjahre. Örtlichkeiten". Werke. Band 2. Herausgegeben von Irene Heidelberger-Leonard und Gerhard Scheit. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2003. 852 S., geb., 40,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Ausgesprochen beeindruckt zeigt sich Rezensent von den ersten beiden erschienenen Bänden dieser Jean-Amery-Gesamtausgabe. Die im vorliegenden Band 5 versammelten Texte zu Literatur und Film, glaubt er jedoch, dienen vor allem einer "archivalischen Komplettierung des Gesamtbildes" von Amerys Werk. Die rund vierzig Texte sind dem Rezensenten zufolge allesamt bereits gedruckt und bekannt. Entdeckungen könne man deshalb nur machen, wenn man sie insgesamt als Mosaik aus Gelegenheitstexten und Auftragsarbeiten verstehe. Die literaturanalytischen Texte ergeben für Schoeller beispielsweise ein Porträt Jean Amerys als Leser, der sich mit Witz und Leidenschaft seine Texte erwarb, sie sich für seine geistige Existenz zurechtschnitt, statt mit der "hochfahrenden Geste des Bildungsbürgers" darüber zu verfügen. In seinen Filmkritiken erweist sich Amery dem Rezensenten als Cineast, der sich von der professionellen Filmkritik immer wieder demonstrativ absetzt. Amery wiederlesend ist Schoeller insgesamt überwältigt von dessen "hoch instrumentierter Rhetorik", seinem "graziösen Stil" und der "Differenziertheit und Verästelung seines Denkens".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH