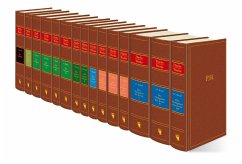Produktdetails
- Verlag: Eulenspiegel
- Deutsch
- Abmessung: 205mm x 257mm x 350mm
- Gewicht: 6620g
- ISBN-13: 9783359015161
- ISBN-10: 3359015169
- Artikelnr.: 11136854
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Autorisiert, klassisch, unendlich: Peter Hacks in fünfzehn Bänden
Darüber, wofür man kommunistische Dichter braucht, wird viel optimistischer Quatsch erzählt - vor allem von Kommunisten und solchen, die gern welche wären, sich aber nicht trauen. Bürgerliche Liberale dagegen sind derzeit weithin von ihrer Fahne gelaufen. Sie haben unter Slogans wie "Postmoderne" in Scharen aufgehört, daran zu glauben, daß ihre Zivilisationsgrundlagen gottgewollt oder gesetzeskräftig sind, und erwarten deshalb auch nicht mehr, daß ihre Welt eine Kunst zuläßt, die nicht bloß zerstreut, sondern ihren Schöpfern ein Stück Unsterblichkeit verschafft. Gerade zu so einem Zeitpunkt braucht man kommunistische Dichter, damit ausgerechnet sie, die ihre Sache auf Erschütterung und Revolution gestellt haben, die Erinnerung an den klassischen Tonfall wachhalten, also daran, daß "ein Stück Unsterblichkeit" Ziel der Künstler sein sollte. Dies wird in Zeiten gerne übersehen, da aus einem "Kalten Krieg" erst eine "Neue Weltordnung" und dann eine Phase hervorbricht, die man am besten "Mal schauen, wer zuerst ausrastet" nennt.
Die Sätze der Reden, die dazu gehalten werden, können semantisch ein gewisses Maß an Willkür nicht unterschreiten. Klassischer Tonfall setzt dagegen darauf, daß es bei der Formulierung von Sätzen einen Grad der Absicht gibt, der nicht Steigerung, sondern Gegenteil von Willkür ist. Er behauptet das beispielhafte Sprachkunstwerk. Wenn es zustande kommt, ist es ein Wunder: planvolle Ausnahme vom Normalen, deren Ausnahmecharakter nicht als Verstoß funktioniert, sondern als Eingriff eines die Regeln beherrschenden Bewußtseins in deren selbsttätige Bewegung.
Schriftsteller, die diese Parallele mit dem Wunderwirker Gott von der heiteren Seite nehmen, weil sie die darin enthaltene Absurdität erkennen, daß ein Endliches sich erfolgreich einem Unendlichen anschmiegt, sind im Vorteil, wenn sie Kommunisten sind. Denn Kommunisten kennen das irdische Reich eines anderen absurden endlichen Gottes: den real existiert habenden Sozialismus. Deswegen also ist der kommunistische Schriftsteller Peter Hacks, der just, am 21. März dieses Jahres, seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag gefeiert hat, als literarische Stimme immer noch so guter Laune. Man lese, um sie kennenzulernen, nur die beiden bislang nicht un-, aber doch unterveröffentlichten dramatischen Texte in seiner jetzt erschienenen Werkausgabe: die Neubearbeitung des Stückes "Numa" und das Dramolett "Der Bischof von China".
In "Numa", einem arkadisch-sozialistischen Stück, das in einem nachrevolutionären Italien spielt, begegnet die Notwendigkeit, daß ein Genosse auch gegen seinen Willen seine Pflicht für den altruistischen Eigennutz beziehungsweise die egoistische Solidarität tun muß, einer Göttin und dem Karneval. Es entspinnen sich diverse Liebeshändel und außerdem eine neue Art Gerichtsposse - der "Zerbrochne Krug" als "Sommernachtstraum" von Brecht, minus diejenigen Anteile von Heiner Müller, die in Brecht wurzeln. Das Stück zeigt einleuchtend, daß es manchmal schon ein Wunder braucht, um aus öden Problemen interessante zu machen.
"Der Bischof von China", nach dem Ende der DDR erstveröffentlicht, tut sich nicht schwerer mit dem historisch-materialistischen Witz: Weise Chinesen, die man leicht als asiatisch-geheimrätliche Verkleidungen gerechten sozialistischen Beamtentums erkennt, schütteln die Köpfe über freche Weiße, deren religiöser Wahnsinn nicht dadurch besser wird, daß er die nötigen Armeen hat, sich als Weltvernunft aufzuspielen. Hier findet ein Dramatiker den Humor darin, daß manchmal sittlich primitive Gesellschaften über sittlich höherstehende triumphieren, und man kann sich denken, an welche Gesellschaften er dabei außerdem denkt und warum er dafür Humor braucht.
Die Alternative dazu, den endlichen Gott als etwas Lustiges anzusehen, wäre ja, ihn ernst zu nehmen. Dann glaubt man, die Kunst sei angewiesen auf die Autorität entsagungsvoller Subjekte. Gute Schriftsteller, die diesen Fehler machen, werden pessimistisch und bald ein bißchen leiernd in ihrem starken, herrischen Ton - da sie davon ausgehen, daß die Menschheit verblödet ist, reden sie nicht mit ihr, sondern mit man weiß nicht wem: Miguel de Unamuno, Arno Schmidt, der späte Flaubert.
Ihre Gegenspieler, die heiteren endlichen Götter, waren nicht immer Kommunisten - Goethe bestimmt nicht - , aber im vergangenen Jahrhundert doch häufig: Bertolt Brecht, Peter Hacks, Ronald M. Schernikau. In der nun begonnenen Phase "Mal schauen, wer zuerst ausrastet" werden vielleicht weitere dazukommen, falls die augenblicklich aufgeregt globalisierende linke Mode sich einmal zu guten literarischen Texten setzt. Auf Hacks werden sich deren Verfasser nicht unbedingt berufen können: Er schrieb Kindermärchen, Traktate gegen jene, die Traktate zum Lob der Romantik schrieben, böse Briefe über Wieland-Philologie und viele andere, durch ihren ästhetischen Anspruch keinesfalls harmlose Texte über eher harmlose Dinge; während die kommunistische Schriftstellerei der Zukunft aufgrund der Tristesse der Umstände wohl erst einmal ästhetisch harmlose Texte über keineswegs harmlose Dinge hervorbringen wird.
Das Verhältnis kommunistischer Dichter zur eigenen Autorität beim Dichten ist entspannt, weil sie das Lösen von Autoritätsfragen an ihre Weltanschauung delegieren können: "Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist", schreibt Lenin. So kennen diese Autoren kaum Autoritäts-, sondern nur noch Qualitätssorgen, deren Bewältigung wiederum Autorität herstellt. Sie haben folglich Glück und reden gern davon. Als beispielsweise die DDR draufging, fiel Peter Hacks auch noch das einzige zu, was die misanthropischen Pessimisten ihm bis dahin uneinholbar voraushatten: die Melancholie. Er nutzt sie sparsam, etwa wenn gestürzte Denkmäler zu bedichten sind. Hacks ist 1928 geboren und 1955 in die DDR übergesiedelt, wie später, unter ganz anderen Umständen, der Dichter Ronald M. Schernikau, an dem Hacks erkannt hat, daß aus ihm etwas hat werden müssen, den er also förderte, der dann leider jung starb und den man lesen wird. Die DDR, in die Hacks kam, sah anders aus als die späte, die Schernikau erlebte. So konnten Hacks' Stücke ohne Panik vor allem von Schwierigkeiten handeln - denen der Politik und der Liebe, den "Sorgen und die Macht" auch, wie eines von 1960 heißt. Selbstbewußt konnten sie sogar aufzeigen, daß Utopien als solche noch nichts Gutes sind, wie der sympathische, aber irregeleitete Anarchist im "Moritz Tassow" von 1961 vorführt.
Hacks für Antikommunisten zurechtzumachen, könnte man versuchen: Dann ist er ein Beherrscher von Reim und Versmaß und ein Freund der sogenannten "Sinnlichkeit". Liest man indes die "sinnlichen" Stücke in dieser Ausgabe, die schon erwähnte Neufassung des "Numa" etwa oder den "Amphitryon" von 1967, wird klar, daß "Sinnlichkeit", auf deutsch Liebe, ihm eben nicht das bedeutet, was sie dem unpolitischen Ästheten lieb macht, nämlich, daß man sich dabei vorstellen kann, es gäbe irgendwelche Schwierigkeiten, auf welche Liebe als solche eine Antwort ist. Liebe ist bei Hacks vielmehr selbst eine Schwierigkeit, eine von den interessanteren, die sich erst einstellen, wenn die der Not vom neuen Paradies behoben sind. Sie wurden es nicht. Das neue Paradies war keins.
Vor Jahren geriet Hacks mit der Arno-Schmidt-Stiftung wegen eines Gedichtes aneinander, in dem er die nachlebenden Diener einer gemütslagenverwandten Dichterautorität als "Schmocks, Wichtigtuer, Trinker" geschmäht hat. Der Zusammenprall ist charakteristisch für einen, der immer auf "Produktion" gesetzt hat und dem die Arbeiterklasse mit dem Künstler gemein hatte, daß sie was herstellt, während der Feind (der Imperialismus, der Philologe) sich am Hergestellten gütlich tut und womöglich die bloß irgendwie gewachsene Gesellschaft für vernünftig hält, weil sie nun mal da ist. Was aber da ist, muß man sich entweder planvoll aneignen oder aus Gründen verwerfen, meint Hacks. Wer so denkt, kann Aristophanes, die Bibel und Goethe seinem Werk assimilieren, er hat vor nichts Angst - ein Vorteil- , ihm graut aber auch vor nichts - ein Nachteil. Die zierliche Gedankenführung des Prosaschriftstellers Hacks gefällt auch da, wo er Unsinn redet - etwa wenn es in ästhetisch-ökonomischen Fragmenten heißt, der Arbeit der Dichter könne die Produktivkraftentwicklung nichts anhaben -, als gäbe es das Versepos wirklich noch, als habe nicht Gutenberg neben anderem auch neue literarische Formen ermöglicht, als wären die nicht wiederum vergänglich. Solche Einlassungen sind zwar klassizistisch, aber unmarxistisch, und, schlimmer: falsch.
Hacks' Verhältnis zur Geschichte regelt der Marxismus; das zur Literaturgeschichte hat er selbst geregelt mit der Arbeit "Das Poetische" von 1972. Sie behauptet: In einer Gesellschaft, die nicht mehr eine der Ausbeutung ist, kann man wieder dauerhafte Werke schaffen, ein Hochplateau ist erreicht. Der Zustand, von dem Hacks da annahm, er sei im realen Sozialismus erreicht, hat auch György Lukács als maßstabgewährend für seine Variante des sozialistischen Realismus behauptet. Adorno widersprach ihm und nannte das eine "erpreßte Versöhnung". Man kann nicht gleichzeitig Hacks zustimmen und Adorno. Aber man kann Adorno zustimmen und Hacks bewundern: Als Dichter, der die Klassik zweimal verteidigt hat - gegen bilderstürmende Romantikrevoluzzer und gegen mutlose Bürger nach dem Kalten Krieg -, wird er sich seiner Nachwelt nicht schämen müssen.
Peter Hacks: "Werke in fünfzehn Bänden". Eulenspiegel Verlag, Berlin 2003. Zus. ca. 5344 S., geb., 450,- [Euro]; br., 360,- [Euro]. Subskriptionspreis bis 30. Juni: geb., 380,- [Euro]; br., 290,- [Euro]., auch einzeln erhältlich.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main