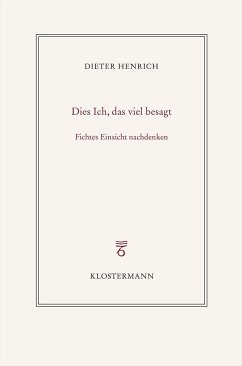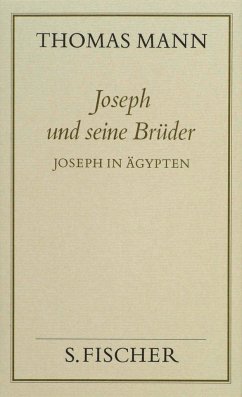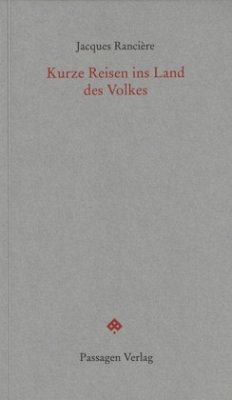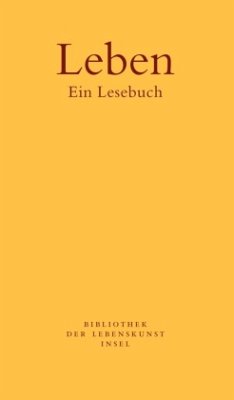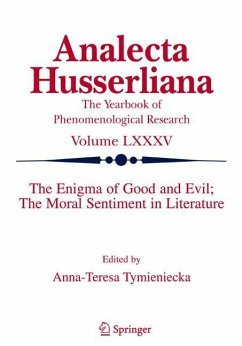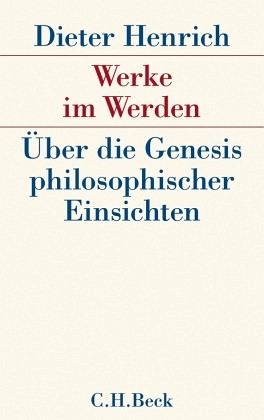
Werke im Werden
Über die Genesis philosophischer Einsichten

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"Philosophie und Literatur haben eine gemeinsame Geschichte. Die Form, in der ein philosophischer Gedanke mitgeteilt wird, hat stets Bedeutung für seinen Gehalt und Zusammenhang. Dieter Henrich geht in diesem Buch der Entstehung von philosophischen Konzeptionen nach und entwirft damit zugleich das Kernstück einer noch ausstehenden Literaturgeschichte der Philosophie. Im ersten Teil des Buches werden die Entstehung und die Werkidee philosophischer Hauptwerke von Descartes, Kant, Hegel, Wittgenstein und Heidegger analysiert. Oftmals spielen in der Genese solcher Werke exzeptionelle Momente der...
"Philosophie und Literatur haben eine gemeinsame Geschichte. Die Form, in der ein philosophischer Gedanke mitgeteilt wird, hat stets Bedeutung für seinen Gehalt und Zusammenhang. Dieter Henrich geht in diesem Buch der Entstehung von philosophischen Konzeptionen nach und entwirft damit zugleich das Kernstück einer noch ausstehenden Literaturgeschichte der Philosophie. Im ersten Teil des Buches werden die Entstehung und die Werkidee philosophischer Hauptwerke von Descartes, Kant, Hegel, Wittgenstein und Heidegger analysiert. Oftmals spielen in der Genese solcher Werke exzeptionelle Momente der Einsicht eine wichtige Rolle. In ihnen wird eine Konzeption gefasst, die Grundprobleme des Denkens löst und zugleich eine Orientierung für das Menschenleben erschließt. Der zweite Teil des Buches entfaltet in kritischer Bezugnahme auf Rorty, Foucault und Quentin Skinner, aber auch auf Hegel eine alte Frage auf neue Weise: In welchem Sinne müssen philosophische Konzeptionen als Produkte einer Kultur verstanden werden und inwiefern kann von ihnen gesagt werden, dass sie Erkenntnis nicht nur anstreben, sondern wirklich gewinnen? Der Weg zu einer Antwort führt in das Zentrum der Philosophie selbst hinein.