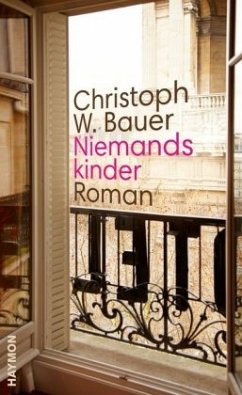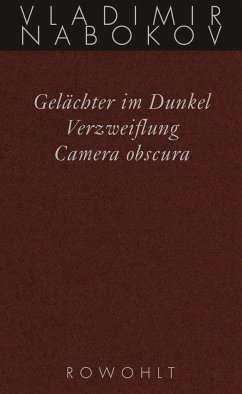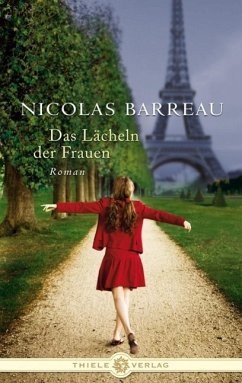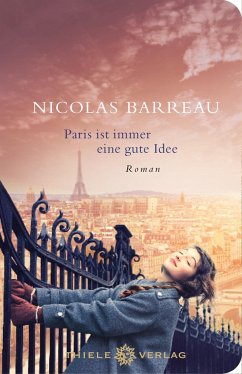Werke in Einzelbänden 3. Das Totenfest
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
24,50 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Handlung fällt in die Zeit des Aufstandes gegen die deutsche Armee in Paris im August 1944. Auf den Dächern der Stadt erfüllt sich durch Verrat und Tod die Liebe zwischen einem deutschen Panzerschützen und einem kollaborierenden Milizsoldaten. Gleichzeitig wird aus der Fülle der Bilder ein einziger, verzweifelter, schmerzlicher Nachruf auf den erschossenen Freund des Dichters.