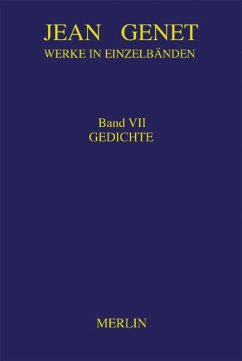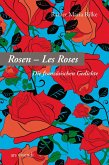Der Band GEDICHTE enthält sämtliche lyrischen Werke des Dichters und Nationalpreisträgers Jean Genet, die als bibliophile Erstausgaben-Einzelbände nur noch teilweise lieferbar sind: Der zum Tode Verurteilte, Der Fischer von Suquet, Ein Liebesgesang, Die Parade, Die Galeere, Trauermarsch und Der Seiltänzer (Übersetzung von Manon Griesebach).
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Ina Hartwig kann sich beim Lesen der Gedichte Jean Genets mit ihrer Mischung aus Pathos und Demut nicht des Gefühls erwehren, dass sie eigentlich nicht in unsere heutige Zeit passen. Und ob sie jemals in irgendeine Zeit gepasst haben, ist sie sich auch nicht sicher. Gerade auch durch die deutsche Übersetzung klinge manches Gedicht noch süßlicher, gesteht Hartwig und möchte doch für diese Gedichte, die für sie eher Gesänge darstellen, eine Lanze brechen, da man ihre Zeit und die düsteren Entstehungsbedingungen berücksichtigen müsse. Genets lyrisches Oeuvre ist klein und stammt größtenteils aus den 40er Jahren, als er noch nicht bekannt war, berichtet die Rezensentin. Genets Karriere als Pflegekind, Messdiener, Soldat und kleiner Delinquent sei zwar bekannt, doch sollte man nicht vergessen, betont Hartwig, dass man damals - als Genet zu schreiben begann - noch für Schwarzfahren und Bücherklauen ins Gefängnis wanderte. Dass sich der Verlag für eine zweisprachige Ausgabe engagiert hat, begrüßt Hartwig. Der Übersetzer habe eine interlineare Übertragung gewagt, was zur Folge habe, dass die Übersetzung reimlos bleibe, wo Genet gereimt habe: mit dem Vorteil der Nüchternheit, um den Preis einer dem Original fremden Melodik und der Chance für den Leser, Original und Übersetzung zu vergleichen, betont Hartwig.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH