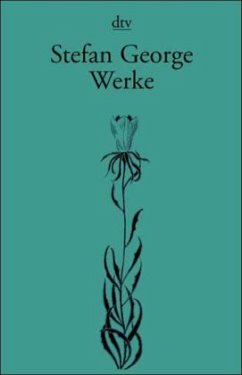Fast siebzig Jahre nach dem Tod Stefan Georges erscheint nach 1983 zum zweiten Mal eine Taschenbuchausgabe seines Gesamtwerks bei dtv - ein Nachdruck der 4. revidierten Auflage der berühmten Küpper-Bondi-Ausgabe, die 1984 nunmehr bei Klett-Cotta erschien. Ursprünglich von seinem Schüler und Erben Robert Boehringer herausgegeben, zeigt der Reprint auch die für Georges Werk eigens entwickelte Typographie und die dem Dichter ästhetisch gewichtige Orthographie, allen voran die konsequente Kleinschreibung. Diese neue Taschenbuchausgabe gibt damit einem breiten Publikum nach einem Jahrzehnt wieder die Gelegenheit, einen der großen deutschen Dichter der Moderne durch und in seinem Werk kennen zu lernen. Dazu gehören nicht nur die wunderbaren und äußerst kunstvollen georgeschen Gedichte selbst, sondern auch die als einzigartig geltenden nachdichtenden Übersetzungen ausgewählter Werke berühmter Autoren wie etwa Dante, Shakespeare, Baudelaire und Mallarmé.
Stefan George, 1868 in Büdesheim bei Bingen geboren, war als Sohn eines wohlhabenden Weingutbesitzers nie zur Berufswahl gezwungen. Nach dem Abitur reiste er durch Westeuropa, studierte zwischendurch in Berlin u.a. Philologie, Philosophie und Kunstgeschichte, traf aber vor allem mit den französischen Symbolisten zusammen. Diese Begegnung bestärkte ihn in seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem in Deutschland verbreiteten literarischen Realismus. Ab 1900 lebte er überwiegend in Deutschland: In München wurde er in der Schwabinger Bohème als Dichterfürst inszeniert und verehrt, in Heidelberg und Berlin verkehrte er in bildungsbürgerlichen Kreisen. 1927 wurde ihm der erste Goethe-Preis verliehen. George zog sich schließlich 1933 nach Minusio zurück, nachdem ihm Josef Goebbels die Präsidentschaft einer neuen deutschen Akademie für Dichtung angeboten hatte. Er verweigerte dieses Angebot und starb am 4. Dezember, betrauert von seinen Schülern und Verehrern.
Stefan George, 1868 in Büdesheim bei Bingen geboren, war als Sohn eines wohlhabenden Weingutbesitzers nie zur Berufswahl gezwungen. Nach dem Abitur reiste er durch Westeuropa, studierte zwischendurch in Berlin u.a. Philologie, Philosophie und Kunstgeschichte, traf aber vor allem mit den französischen Symbolisten zusammen. Diese Begegnung bestärkte ihn in seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem in Deutschland verbreiteten literarischen Realismus. Ab 1900 lebte er überwiegend in Deutschland: In München wurde er in der Schwabinger Bohème als Dichterfürst inszeniert und verehrt, in Heidelberg und Berlin verkehrte er in bildungsbürgerlichen Kreisen. 1927 wurde ihm der erste Goethe-Preis verliehen. George zog sich schließlich 1933 nach Minusio zurück, nachdem ihm Josef Goebbels die Präsidentschaft einer neuen deutschen Akademie für Dichtung angeboten hatte. Er verweigerte dieses Angebot und starb am 4. Dezember, betrauert von seinen Schülern und Verehrern.

Der Staat des Dichters Stefan George, der Verrat und der ästhetische Fundamentalismus / Aus Anlaß der Studie von Stefan Breuer
Viele, die Stefan George begegneten, bekamen es mit der Angst zu tun. Ernst Bertram, der ihm in einem Münchner Salon vorgestellt wurde, glaubte, einen Werwolf vor sich zu haben. "Er kann töten, ohne zu berühren", schrieb mit deutlichen Anzeichen der Panik Hugo von Hofmannsthal nach der ersten Zusammenkunft. Ida Coblenz, die einzige Frau, um die George je warb, sprach von dem Grauen, das der Mann stets in ihr geweckt habe. Und noch nach Jahren der Bekanntschaft wurde die verehrungsbereite Sabine Lepsius bei einem Spaziergang von "der plötzlichen, ich möchte fast sagen bösen Wirkung" des Dichters so überwältigt, daß sie sogar ihr Kind vor ihm in Sicherheit brachte.
Ohne Zweifel war diese Wirkung gewollt und das Ergebnis eines weit zurückreichenden Stilisierungsprozesses. Ein Klassenkamerad hat, als die hochfahrende Unnahbarkeit Georges längst zum öffentlichen Ereignis geworden war, geschildert, wie der Sechzehnjährige 1885 im sozialen Kleinmilieu der Schule gewirkt hatte: "Die grauen, undefinierbaren Augen, niemand eines Blickes würdigend, zum Fenster hinaus gerichtet - so lehnte er uns alle restlos ab."
Stefan George, 1868 in Büdesheim bei Bingen als Sohn eines Weinhändlers geboren, ist die rätselhafteste Erscheinung der deutschen Literatur dieses Jahrhunderts. Sein Gedichte sind geworden, was in den Worten Nietzsches die Musik Richard Wagners war, "die erste Weltumsegelung im Reiche der Kunst; wobei nicht nur eine neue Kunst, sondern die Kunst selber entdeckt wurde". Aber diese große Expedition ist heute vergessen, mitsamt den Gedichten Georges in den Tiefen der Erinnerungslosigkeit versunken. Kaum einer liest ihn, kaum einer kennt seine Gedichte. Theodor W. Adorno, der in seiner Jugend nicht zufällig Verse des Dichters vertonte, hat Anfang der fünfziger Jahre noch einen Teil des Georgeschen Erbes retten wollen.
Adornos Versuch ist ebenso gescheitert wie die Bemühung all seiner um 1900 geborenen Generationsgenossen, deren Jugend- und Studienzeit sich unter dem ebenso verborgenen wie übermächtigen Einfluß des Dichters abspielte. Der heute fast Vergessene übte in den ersten dreißig Jahren dieses Jahrhunderts eine einzigartige Autorität aus und bildete, einem Wort Walter Benjamins zufolge, eine geistige Gegenmacht, von der schließlich ganze Fakultäten und Universitäten, Wissenschaftler, Teile des Beamtenapparats, Repräsentanten und einfache Mitglieder der Reichswehr, später der Wehrmacht und schließlich auch Politiker geprägt wurden. Er hat vor allem durch die Attitüde seiner radikalen Weltmißbilligung gewirkt und jenen Kräften Sprache verliehen, die in dem Vorhandenen eine Beleidigung des Gewesenen und im Gewesenen ein Anleitung für das Mögliche sahen. Der Kreis einfältiger, genialischer und zuweilen auch genialer Männer, die er um sich versammelte, hat auf Literatur, Wissenschaft, Politik und am Ende, in einer letzten verzweifelten Geste, auch auf die deutsche Geschichte eingewirkt.
George gehörte zu jenem im Europa der Jahrhundertwende fast gleichzeitig und fast überall auftauchenden Typus der von der Kunst gleichsam umgeleiteten und aufgehaltenen Täter-Natur. Die ethische Bindungskraft der Kunst vermag schon in der nächsten Generation die Abirrenden und bürgerlich Desorientierten nicht mehr aufzufangen. Die entgleisten, ebenso ehrgeizigen wie von mangelnder Anerkennung zermürbten Halbbegabungen brechen unter dem Eindruck des Krieges gleichsam durch den Boden, den die Kunst den Älteren noch bereitete, und tragen die fehlgeleitete, nach Großen und Größten zielende Energie der Künstlernatur in die revolutionäre Politik. Hitler ist dafür das folgenreichste Beispiel geworden, aber auch Joseph Goebbels, der als Student in Heidelberg verbittert, wenn nicht um den Zugang zum George-Kreis, so doch um die Anerkennung seines wichtigsten Repräsentanten, Friedrich Gundolf, warb.
George steht genau an der Scheidelinie dieser Generationen, und immer wird unklar bleiben, wie er sich, wenn er nicht im Dezember 1933 gestorben wäre, zum Nationalsozialismus (dessen Ehrungen er ablehnte) letztlich verhalten hätte. Er selber hat einmal bemerkt, er hätte womöglich die Welt verändert, wenn er den Ersten Weltkrieg als jüngerer Mann erlebt hätte. Unter den Gleichgesinnten seiner Generation, unter all den Klages, Schuler, Derleth, die das Schwabing der Jahrhundertwende mit cäsarischen und terroristischen Phantasien bevölkerten, war er nicht nur der Bedeutendste, sondern, nach der Einschätzung Rudolf Borchardts, auch der Gefährlichste. George war als Herold der künftigen Generation einer der großen Verschärfer im Reich der Kunst, das ihm gleichbedeutend mit der Welt des Sozialen wurde. Er hat der deutschen Literatur zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein unversöhnliches Entweder-Oder eingegeben, das mit existentiellen Opfern und in einigen Fällen sogar mit dem Leben bezahlt wurde. Seit seinem dreißigsten Lebensjahr war er überzeugt, daß die Welt am Vorabend eines großen schismatischen Jahrhunderts stehe. Er hat in einem geradezu barbarischen Akt der historischen Rückwendung eine Glaubensspaltung in der Literatur betrieben, einen Gegenstaat gegründet und gleichzeitig, wie nicht nur Bertolt Brecht, sondern auch Rudolf Borchardt auffiel, die Regeln des modernen Marktes glänzend beherrscht.
Stefan George hat, aus welchen psychosozialen Motiven auch immer, seine Abwehr und Absonderung bis zuletzt gelebt und den Menschen das Gefühl hinterlassen, sie eigentlich alle restlos abzulehnen. Der Jüngling unterschied, als er im Paris der Symbolisten Mallarmé zu Füßen saß, nur zwischen dem Schönen und dem Häßlichen. Einige Jahre später, als der Lyriker einen Kreis gleichberechtigter Freunde um sich gesammelt hatte, wurden ihm Schönheit und Häßlichkeit zu Synonymen für Liebe und Haß. Aber seine Herrschaft über die Menschen begann erst, als er all dies auf den Urkonflikt zwischen Freund und Feind zurückführte. Die Unerbittlichkeit, mit der er fortan zwischen gut und böse, schön und häßlich, Freund und Feind unterschied, hat bei seiner Gefolgschaft überwältigende Glücksmomente und ebenso schreckliche Tragödien ausgelöst.
Ekel, Haß und Gewalt - das waren, wie die überlieferten Zeugnisse belegen, keine Worte mehr wie noch in dem frühen Gedichtband "Algabal", sondern psychische Tatsachen von großer Intensität. Auch die Liebe war es. So sehr, daß die unmittelbar Beteiligten noch in ihrer Erinnerung von der Unfaßbarkeit des Ereignisses überwältigt wurden. Zu den wenigen Dokumenten, die die Ambivalenz einbekennen, gehört eine Notiz von Ernst Glöckner, in der er seine Prüfung durch George beschreibt: "Ich haßte und liebte den Menschen zu gleicher Zeit aus tiefster Seele. Ich zitterte und bebte am ganzen Körper. Ich wußte, der Mensch tut dir Gewalt an - aber ich war nicht mehr stark genug. Ich küßte die dargebotene Hand und mit versagender Stimme flüstere ich: ,Meister, was soll ich tun?' Er zog mich an seiner Brust empor, umarmte mich und küßte mich auf die Stirne . . . Mir war wohl und süß, und doch verachtete ich mich in diesem Augenblick so, wie ich mich noch nie verachtet hatte. Ich war ihm dankbar und haßte ihn in einem Atem. Es war furchtbar."
Wie alle Herrscher hatte er eine Witterung für den Verrat. Er las ihn, wie ein Freund überlieferte, an den Augen ab. In Briefen, die von nichts als Verehrung und Liebe sprachen, spürte er den Hauch kommender Untreue. Weil Ernst Bertram in seinem Nietzsche-Buch Thomas Mann erwähnte und auch sonst mit ihm Umgang pflegte, wurde er als unsicherer Kantonist verdächtigt. Stets kam der Moment, in dem George über Freund und Feind entschied, zuweilen, wie etwa im Fall Edgar Salins, ohne daß die Beteiligten die Gründe kannten. Hugo von Hofmannsthal, der sich ihm entzog, Ida Coblenz, die sich nicht für ihn, sondern für Richard Dehmel entschied, Friedrich Gundolf, der eine unerwünschte Ehe einging, Max Kommerell, der, wie er später bemerkte, flüchtete, um sein Leben in Sicherheit zu bringen - wohin man schaut, trifft man bei ihm auf dieses unheilbare Erlebnis des Verrats. Niemals ist ein Vertriebener wieder aufgenommen worden, nie ein Abtrünniger zurückgekehrt. Das Motiv des Verrats durchzieht Leben und Werk Stefan Georges von den ersten Algabal-Gedichten bis zu den späten Mahnversen im "Neuen Reich".
Aber auch die Abtrünnigen glaubten zeitlebens, wirklich etwas verraten zu haben, und manche von ihnen haben noch Jahrzehnte später Schriften mit diffizilen Rechtfertigungen und Selbsterklärungen publiziert. Friedrich Gundolf etwa, eine der genialsten Erscheinungen des Kreises, hat, nachdem er wegen seiner Heirat mit Elisabeth Salomon verstoßen wurde, folgende Verse an George gerichtet: "Nicht um vergebung will ich flehen / Das urteil ist
Fortsetzung auf der folgenden Seite
mir innen kund / Was ich getan ist mir geschehen / Ich bin die strafe und ihr grund." Nur wenigen gelang die Lösung, und in der gesamten Literatur des Kreises gibt es überhaupt nur eine einzige Stelle, die den Kreis aus der Sicht des Renegaten schildert.
Sie stammt von Max Kommerell, der zu den Lieblingsjüngern des gealterten Dichters zählte und als Nachlaßverwalter vorgesehen war. "Das ganze Umeinanderleben", so hat er die Zusammenkünfte des Kreises geschildert, "beruhte auf einer so vollständigen Aufgabe des persönlichen Selbstgefühls, wie ich sie höchstens für einen Jüngling, niemals für einen Mann angemessen und erträglich nennen kann . . . Ich sah mich und andere gedemütigt." Aber selbst Jahre nach Georges Tod berichtet er in Briefen von Schreckensträumen, in denen er sich zu rechtfertigen habe, und noch auf dem Totenbett soll er, einer apokryphen Überlieferung zufolge, den Satz gesagt haben: "Dies ist der Pfeil des Meisters."
Keiner konnte, eigenem Eingeständnis zufolge, mehr hassen als er. Sein Satz, er sei nicht zum Heilen da, zeigt, daß er wie jeder Revolutionär die Gegensätze verschärfen und emportreiben wollte, um sie schließlich zu lösen. Es war Rudolf Borchardt, der die bürgerkriegsähnlichen Konsequenzen aus Georges Politik am deutlichsten formuliert hat. In einer berühmten Passage spricht er von der "allgemeinen manieristischen und sadistischen Gebrauchstyrannei", die George ausübe. "Ich kann mein leben nicht leben es sei denn in der vollkommnen äußerlichen oberherrlichkeit", heißt es in einem Brief an Lepsius. Und in merkwürdiger Unbefangenheit äußert er später mit Blick auf das "schöne Leben", es sei besser, zu sterben, als dem ästhetischen Gesetz zu entraten.
Und dennoch geht das Muster von Treue und Verrat in keiner Erklärung je auf. Denn zu der Erscheinung Georges gehört ihr geschichtsmystischer Überbau, der sich nur äußerlich in der Attitüde des Seherischen und Prophetischen abbildet. Gewiß hat er den Verrat als mächtiges Tabu im Innersten seines Kreises aufgerichtet. Wahr ist aber auch, daß zu seinen jüngsten und nachhaltig geprägten Gefolgsleuten Berthold und Alexander Graf von Stauffenberg gehörten, die in den Stunden ihrer Entscheidung den Vorwurf des Verrats an Hitler gegen die Treue zu der Welt Georges aufrechneten. Zur gleichen Zeit versteckte in Amsterdam Wolfgang Frommel, Angehöriger der letzten Generation, die George noch sah, jüdische Kinder vor den Deutschen, rezitierte Gedichte und lebte mit ihnen nach den Regeln des Kreises. Daß George, der von sich behauptete, sein Gesundheitszustand spiegele den Zustand Deutschlands, im Jahre 1933 gestorben war, schien diesen wie eine endgültige Aussage über das Wesen des Nationalsozialismus. Das sagt nichts über den objektiven Wert des Kreis-Erlebnisses, aus dessen Mitte auch überzeugte Nationalsozialisten stammten, aber es addiert zu dem Phänomen dieses Dichters jenen unerklärbaren Rest, den keine Analyse je aufzulösen vermag.
Das ist es auch, was am meisten gegen die Studie von Stefan Breuer spricht. Der Autor, dem wir eine hervorragende Arbeit zur konservativen Revolution verdanken, hat nun unter dem Titel "Ästhetischer Fundamentalismus" eine Analyse von Stefan George und seinem Kreis vorgelegt. Manche, insbesondere die noch verbliebenen Georgianer, wird die psychopathologische Methode Breuers irritieren. Anderen wird nicht einleuchten, wieso der Soziologe Breuer den Kreis mit aktuellen Sekten in Verbindung bringt.
Dies abgerechnet, bleibt ein Werk übrig, das auch den Kenner der Literatur in Erstaunen versetzt. Breuer hat erstmals die soziale und psychische Konstitution der Jünger ergründet. Er ist ihrer rätselhaften Hingebungs- und Unterordnungsbereitschaft nachgegangen und hat ein Persönlichkeitsbild entworfen, das in nahezu allen Details überzeugend ist. Fast durchweg sind sie unglückliche Akademiker, solche, denen die Universitätskarriere nichts gibt oder die sie mit unendlicher Langeweile quält. Fast alle haben sie in ihrer Pubertät einen biographischen Bruch, der stärker und lebensbedrohlicher ist als bei vergleichbaren Altersgenossen. Sie wechseln, wie Ernst Glöckner und Friedrich Gundolf, zwischen Selbstüberschätzung und völliger Selbstverachtung. Sie haben, wie Breuer exemplifiziert, "Angst zu zerbröckeln oder zerfließen (Glöckner)" oder "Angst, irgendwie von den Quellen des Lebens, von den nährenden Wurzeln, den Instinkten, abgeschnitten zu sein" (Gundolf).
Eine im Klischee gebliebene Kritik hat in den letzten Jahrzehnten George immer wieder als Täter und Tyrannen und als einen in exzentrischem Berufungswahn verstrickten Patriarchen geschildert. Gewiß war er all das, aber wesentlicher aus der Perspektive des Kreises war eine andere Eigenart, die Breuer mit großer Klarheit als erster bemerkt hat: "Zu George kommt man nicht in einem Zustand der Stärke und des Selbstvertrauens. Man kommt zu ihm vielmehr wie ein Patient zum Arzt, ein Kind zur Mutter. Es wäre deshalb falsch, in ihm nur den Despoten zu sehen, der mit hypnotischer Gewalt die Seelen in seine Abhängigkeit zwänge. Wie der Meister seine Jünger braucht, so brauchen umgekehrt sie ihn - mit der freilich nicht unwesentlichen Nuance, daß sie ihn ständig brauchen, während er seine Objekte nur zeitweise benötigt und leicht austauschen kann."
Breuer schildert George als die gute und die böse Mutter - ein überraschender Befund, der unmittelbar einleuchtend wird, wenn man sich der Schwabinger Feste erinnert, bei denen die Kosmiker Klages und Schuler in wahnhaften Séancen als Männer Kinder gebären wollten. George hatte damals die Kosmiker mit dem Hinweis abgefertigt, seine Mission sei es, Gedichte zu schreiben und nicht ein Narrenhaus zu bevölkern. Aber schon früh hat er selber sich auf Platon berufen, als er den Kult der Doppelgeschlechtlichkeit, womöglich auch zu Tarnungszwecken, zu einem Motiv seiner Lehre machte.
Breuer ordnet George in den Zusammenhang des deutschen Antimodernismus ein. Jene Traktat- und Proklamationszeit, der Thomas Mann entscheidende Passagen seines "Dr. Faustus" gewidmet hat, mit ihren Ängsten vor dem "Untergang der Seele", hatte in George ihren Exponenten und Verkündiger. Mehr noch - und das gezeigt zu haben ist das Verdienst Stefan Breuers - spiegelt sie sich in den Physiognomien und Biographien der Kreismitglieder. Sie, die mit wenigen Ausnahmen nicht die Vorzüge des Genies auf ihrer Seite hatten, bebildern in ihren Ängsten und Abhängigkeiten die Widersetzlichkeit des akademischen Bürgertums vor der durch den Ersten Weltkrieg mit aller Brutalität triumphierenden Moderne. Man wird nicht jeder der Thesen dieses Buches zustimmen, insbesondere nicht dem Gedanken, Rudolf Borchardt habe die Rolle Georges spielen wollen. Aber in ihrer Gesamtheit ist Breuers Studie bis ins Detail von einem Gedankenreichtum, den man nicht nachdrücklich genug rühmen kann.
Friedrich Wolters hatte mit dem 1907 erschienenen geistesgeschichtlichen Traktat "Herrschaft und Dienst" so etwas wie die Verfassung des Staates geschrieben, in dem Stefan George herrschte. Das Buch ist über alle Maßen befremdlich und hat der Georgeschen Vorstellungswelt zuerst den Ruf der Tyrannei eingebracht. Das "Herrscherliche", so hat er dem Dichterfreund Albert Verwey einmal gestanden, sei ihm nicht fremd. Schon der Dreißigjährige schlägt Hofmannsthal vor, eine Diktatur in Kunstdingen einzurichten. Kurz darauf sieht er sich an der Spitze einer "Geistigen Bewegung", wie die von Gundolf und Wolters herausgegebene Zeitschrift hieß, und wird zum Meister seines Kreises. 1919 scheint er alles für möglich zu halten, und wenn auch leider die Zeugnisse gerade für diesen Zeitraum spärlich sind, so spricht doch einiges dafür, daß er von den revolutionären Ereignissen aufs höchste erregt ist und ein persönliches Eingreifen in den politischen Prozeß für möglich hält.
Dieser bekannten Außenansicht der Verhältnisse stellt Breuer die Innenansicht, das seelische Geschichtsbild, gegenüber. Er hat in gewisser Weise "Herrschaft und Dienst" ein zweites Mal, diesmal nicht unter dem mystischen Fackelschein der Blutleuchte, sondern im Licht der analytischen Vernunft, geschrieben.
Und dennoch gibt es einen Einwand, der auf den unerklärlichen Rest dieses Lebens zielt. George hat nicht nur Relikte einer beispiellosen Wirkung hinterlassen. Manche seiner Gedichte (deren Schwächen Rudolf Borchardt meisterhaft notierte) verfügen noch heute - und fast ist man geneigt zu sagen: heute immer mehr - über eine Schönheit und Intensität, der man nicht viel anderes zur Seite stellen kann. In dem "Zeitgedicht" des Bandes "Der siebente Ring" hat sich George von dem Erfolg seines poetischsten Buchs, des "Jahres der Seele", distanziert und auch seinen Anhängern später das Lesen daraus fast nie gestattet. Aber die tiefe Melancholie dieses Buches findet noch einmal eine unendlich leichte, fast unbeschwerte Antwort in einigen der vollkommenen Gedichte seiner letzten Veröffentlichung, des "Neuen Reichs". Wie sie entstehen konnten, darauf hat auch Breuer, darauf haben auch wir keine Antwort.
Man wird sich mit seinen Gedichten bald noch einmal befassen müssen, entlastet nun von der Aufgabe, dem Leben dieses eigentümlichen Menschen nachzuspüren. Es sind Gedichte, wie man sie in diesem Jahrhundert nicht oft gelesen hat. Von einem sagte des Dichters großer Gefolgsmann Theodor W. Adorno, es speichere das "Gefühl eines ganzen Weltalters" auf:
Ihr tratet zu dem herde
Wo alle glut verstarb'
Licht war nur an der erde
Vom monde leichenfarb.
Ihr tauchtet in die aschen
Die bleichen finger ein
Mit suchen tasten haschen -
Wird es noch einmal schein!
Seht was mit trostgebärde
Der mond auch rät:
Tretet weg vom herde
Es ist worden spät.
Stefan Breuer: "Ästhetischer Fundamentalismus". Stefan George und der deutsche Antimodernismus. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995. 272 S., br., 49,80 DM.
Stefan George: "Werke". 2 Bände. Hrsg. von Robert Boehringer. 4. Auflage. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 1984. 563 S. und 627 S., geb., je 60,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main