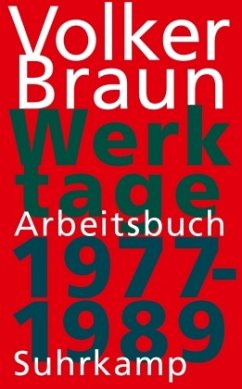Unbekanntes, hoch Wichtiges ist zu vermelden. Volker Braun hat, beginnend im Januar 1977, bis in die Gegenwart ein Werktagebuch geführt. Dessen erster Band, teils kurze, teils längere Notate, erlaubt nicht allein den erhellenden Einblick in die Werkstatt des "lauteren, spielwütigen Autors". Solche Mitschriften des täglichen Lebens machen erfahrbar, wie Volker Braun sich und seine Arbeit, die Kollegen und die politische Situation - in Ost und West - sieht. Und seine Beobachtungen, mal giftig, mal ironisch, Reflexionen und Erzählungen zeigen erneut die Kunst dieses Dramatikers, Lyrikers und Prosaisten: Mit jedem Satz von ihm steigert er humoristisch-traurig die Einsicht in die Verbesserungswürdigkeit und Verbesserungsnotwendigkeit unserer Lage.In diesem Lebens-, Lese- und Arbeitsbuch ist also zu erfahren, wie Volker Braun nach der Publikation der Unvollendeten Geschichte - 1975 in der DDR, 1977 in der BRD - seine Dramen zum Druck befördert und auf die Bühne bringt, wie er listig den Hinze-und Kunze-Roman zuerst in Frankfurt und dann in Halle veröffentlicht, was die im Westen so alles mit ihm anstellen, warum er 1988 das Stück Lenins Tod schreibt, und im Jahr 1989 der erste Band seiner Werkausgabe erscheint.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
An sich natürlich eine faszinierende Sache, meint der Rezensent Jens Bisky über die Tagebuchnotizen und Werkberichte des Schriftstellers Volker Braun aus dem letzten Jahrzehnt der Deutschen Demokratischen Republik. Und in der Tat gibt es manch Interessantes zu lesen, über die Widerstände, gegen die auch ein hoch renommierter Autor wie Braun ankämpfen musste, oder Einsichten wie die über das strukturell begründete Versagen der DDR auf dem Gebiet komplexerer Technologie. Dies alles oft brillant und poetisch formuliert, auch dagegen hat der Rezensent nichts einzuwenden. Und ärgert sich doch, und zwar ziemlich, über dieses Buch. Weil er sich fast völlig alleingelassen fühlt mit diesen Alltagsnotizen. Namen werden nicht eingeordnet, Hintergründe nicht erklärt. Bleibt also nur die Ambivalenz: Faszinierend, aufschlussreich einerseits. Ein unnötig versiegeltes Buch für die meisten Leser zum andern.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH