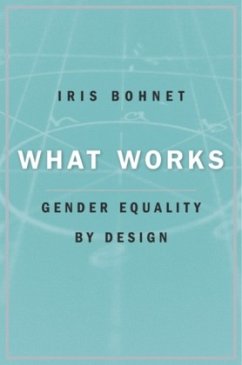Building on new insights into the human mind, and drawing on data collected by companies, universities and governments throughout the world, a behavioral economist at Harvard University presents research-based solutions for addressing gender bias, improving lives and performance that have big impacts?often at low cost and high speed.

Gretchenfrage: Sollen Frauen sich verstellen, um beruflich erfolgreich zu sein? Die Verhaltensökonomin Iris Bohnet zeigt einen besseren Weg.
Von Julia Bähr
Frauenzeitschriften sind berüchtigt für ihre sonderbaren Ratschläge, die im Wesentlichen dafür sorgen, dass die Leserin sich anschließend unzulänglich fühlt. Neben dem ungeschlagenen Klassiker-Thema Diät gibt es dort eine gar nicht so unbedeutende Nische, die sich damit befasst, wie Frauen im Job auftreten sollen, um ernster genommen zu werden. Die meisten dieser Tipps lassen sich unter "Benehmen Sie sich wie ein Mann" zusammenfassen. Und der Vorschlag, Männerparfüm zu benutzen, um besonders herb und damit wohl kompetent zu wirken, ist noch lange nicht der abwegigste.
Deshalb ist es besonders wohltuend, dass die in Harvard lehrende Verhaltensökonomin Iris Bohnet in "What works" die Sache von einer anderen Seite anpackt. Nicht die Frauen sollen sich ändern, um beruflich voranzukommen. Stattdessen sollen die Vorgesetzten und Personalchefs sich bewusst machen, dass tief verwurzelte Vorurteile ihre Entscheidungen beeinflussen und manche Strukturen kompetitive Naturen begünstigen - zu denen statistisch gesehen deutlich mehr Männer zählen.
Das ist nicht nur ein fairerer und vernünftigerer Ansatz als der Vorschlag, die eine Hälfte der Menschheit möge ihr Auftreten dem der anderen Hälfte angleichen, sondern wissenschaftlich begründet: Bohnet zitiert Studien, die ergeben, dass eine Frau mit klassisch männlichem Auftreten als unsympathischer wahrgenommen wird. Den Job bekommt in diesem Fall also weder die Frau, die sich sympathisch bescheiden gibt, noch die aktiv für sich werbende Frau, die damit ihre Sympathiepunkte verliert. Den Job bekommt der Mann, dessen Eigenwerbung ihn nicht unsympathisch wirken lässt, weil sie von ihm geradezu erwartet wird. "Bei Frauen funktioniert es nicht nur nicht, sondern Frauen, die es auf diese Weise versuchen, werden dafür auch noch bestraft", schreibt Bohnet.
Aber wozu das alles? Warum sollten Unternehmen umdenken, statt einfach weiter bevorzugt Männer einzustellen und zu fördern? Weil es sich für sie lohnt. Iris Bohnet zeigt das vor allem im ersten Teil ihres ausgezeichnet strukturierten Buches. Zum einen arbeiten gemischte Teams effektiver, zum anderen können Firmen aus viel mehr qualifizierten Kräften auswählen, wenn sie ihre Abläufe so modifizieren, dass Männer und Frauen gleichermaßen vorankommen können.
Das bezieht sich nicht nur auf Leistungsevaluierung, wo sich etwa bei der Selbstbewertung Frauen immer schlechter einschätzen als Männer und für diese Bescheidenheit dann meist auch noch mit geringeren Bewertungen ihrer Vorgesetzten bestraft werden, die sich davon beeinflussen lassen. Es fängt viel früher an - bei der Stellenausschreibung, die geschlechtsneutral formuliert werden sollte, wenn das Unternehmen wirklich die Besten will und nicht nur die besten Männer. Dieser kapitalistische Ansatz lässt erfreulicherweise gar keinen Platz für Kategorien wie Gerechtigkeit und Gesinnung. Außerdem ist jede Argumentationslinie in "What works" akkurat mit Studien belegt, deren Anzahl und Vielfalt beeindruckt - vor allem bei jenen, die nicht an der Universität entworfen wurden, sondern vom echten Leben. In Indien etwa legte die Regierung 1993 fest, dass künftig bei einem Drittel aller Dorfräte eine Frau den Vorsitz bekommen müsse. Die Dörfer wurden ausgelost; die Bewohner waren skeptisch, schließlich kannten sie nur Männer in dieser Position. Aber die Frauen machten sich gut: "Sie stellten mehr wichtige öffentliche Güter zur Verfügung wie Trinkwasser, Straßen und Bildung, steigerten die Quote der angezeigten Verbrechen (einschließlich Vergewaltigungen) und nahmen weniger Bestechungsgelder an als ihre männlichen Kollegen." Entsprechend sank die Voreingenommenheit der Dorfbewohner gegenüber Frauen an der Spitze, die in Westbengalen erhoben wurde.
"Männliche Dorfbewohner, die nie eine Frau in einer Führungsrolle erlebt hatten, bewerteten sie konsequent schlechter als Männer. Aber männliche Dorfbewohner, die Frauen in der Führungsrolle erlebt hatten, bewerteten männliche Vorsitzende als weniger effizient." Allerdings fanden sie die weniger effizienten Männer trotzdem sympathischer - Frauen haben nicht dominant aufzutreten, in diesem Urteil sind der Westbengale vom Dorf und der Personalchef im Silicon Valley sich offenbar ganz einig. Beide lassen sich dadurch gutes Führungspersonal entgehen.
Solche Studien sind die Basis, auf der Iris Bohnet ihre Empfehlungen für Unternehmen aufbaut. Sie berät seit Jahren Firmen, wie sie durch kleine Änderungen der Spielregeln mehr qualifizierte Frauen anziehen und ihr Potential optimal nutzen können. Und nicht nur Frauen - auch die Angehörigen anderer Ethnien fallen oft durch das Raster von weißen Personalchefs, weil der Mensch dazu neigt, Ähnlichkeit mit Sympathie gleichzusetzen. Deshalb gibt Bohnet praktische Tipps für das Führen von Vorstellungsgesprächen, die die Entscheider davon abhalten, in einen Plausch abzuschweifen und am Ende einfach denjenigen einzustellen, der aussieht wie ihr eigener Sohn. Wer mindestens eine Tochter hat - auch dazu gibt es eine Studie - stellt mit höherer Wahrscheinlichkeit Frauen ein.
Diese Leitfäden müssen sein, denn ganz ohne Selbstkontrolle und -beobachtung überwindet niemand seine Vorurteile. Schließlich kann man nicht in jeder Branche das anwenden, was die amerikanischen Orchester in den siebziger und achtziger Jahren einführten: Nachdem der Frauenanteil 1970 bei fünf Prozent lag, ließen sie in den Folgejahren Bewerber in der ersten Vorstellungsrunde hinter einem Vorhang spielen. Auf diese Weise wurde niemand aufgrund von persönlichen Vorurteilen bevorzugt. Prompt stieg der Anteil an Frauen in der zweiten Runde um die Hälfte. Inzwischen sind mehr als fünfunddreißig Prozent der Orchestermitglieder weiblich. Damit sind sie deutschen Vorstandsgremien weit voraus.
Iris Bohnet: "What works". Wie Verhaltensdesign die Gleichstellung revolutionieren kann.
Aus dem Englischen von Ursel Schäfer. C. H. Beck Verlag, München 2017.
381 S., geb., 26,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main