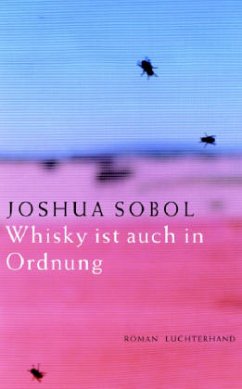In seinem zweiten Roman schickt Joshua Sobol, einer der führenden israelischen Dramatiker, seinen Helden auf eine gefährliche Mission, die vergangene Verbrechen endgültig sühnen soll. Ein ironisches Verwirrspiel um Identität, Literatur, Gewalt und Liebe, das die Geschichte Israels mit der Frage verknüpft, ob das Böse aus der Welt zu schaffen sei.
Hanina Regev hat viele Identitäten, je nachdem, wen man fragt. Ein Star in der Werbebranche. Ein Dichter. Mossad-Agent. Frauenheld. Whiskykenner. Selbst nennt er sich u. a. Shakespeare, Shylock, Nino, je nachdem, in welcher Situation und Gesellschaft er sich befindet und welche Rolle er gerade spielt. Er ist so rätselhaft und vielschichtig wie die israelische Identität und das jüdische Schicksal selbst.
Nach seinem Dienst in der israelischen Armee hat sich Hanina einem Sonderkommando angeschlossen, das weltweit Terroristen und Mörder aufspüren soll. Bei einem Einsatz in der libyschen Wüste kamen damals zwei seiner Kameraden ums Leben, und heute, achtzehn Jahre später, hat Hanina das Gefühl, dass die Geschichte immer noch nicht abgeschlossen ist; er ist überzeugt, dass der Mörder seiner Kameraden noch lebt. Als er eines Tages in Manhattan einen Termin für seine Werbeagentur wahrnehmen will, entdeckt er einen Mann, der diesem Mörder verblüffend ähnlich sieht. Eine rasante Jagd beginnt, und bis sie, wieder in einer Wüste, zu einem überraschenden Ende führt, muss Hanina nicht nur seine Ehe und seine Freundschaften hinterfragen, sondern sich auch seiner Vergangenheit und seinen Überzeugungen stellen.
In diesem hintersinnigen, virtuoserzählten Roman erweist sich Joshua Sobol erneut als wortgewaltiger und humorvoller Chronist seines Landes.
Hanina Regev hat viele Identitäten, je nachdem, wen man fragt. Ein Star in der Werbebranche. Ein Dichter. Mossad-Agent. Frauenheld. Whiskykenner. Selbst nennt er sich u. a. Shakespeare, Shylock, Nino, je nachdem, in welcher Situation und Gesellschaft er sich befindet und welche Rolle er gerade spielt. Er ist so rätselhaft und vielschichtig wie die israelische Identität und das jüdische Schicksal selbst.
Nach seinem Dienst in der israelischen Armee hat sich Hanina einem Sonderkommando angeschlossen, das weltweit Terroristen und Mörder aufspüren soll. Bei einem Einsatz in der libyschen Wüste kamen damals zwei seiner Kameraden ums Leben, und heute, achtzehn Jahre später, hat Hanina das Gefühl, dass die Geschichte immer noch nicht abgeschlossen ist; er ist überzeugt, dass der Mörder seiner Kameraden noch lebt. Als er eines Tages in Manhattan einen Termin für seine Werbeagentur wahrnehmen will, entdeckt er einen Mann, der diesem Mörder verblüffend ähnlich sieht. Eine rasante Jagd beginnt, und bis sie, wieder in einer Wüste, zu einem überraschenden Ende führt, muss Hanina nicht nur seine Ehe und seine Freundschaften hinterfragen, sondern sich auch seiner Vergangenheit und seinen Überzeugungen stellen.
In diesem hintersinnigen, virtuoserzählten Roman erweist sich Joshua Sobol erneut als wortgewaltiger und humorvoller Chronist seines Landes.

Spiel mit Identitäten: Ein Roman von Joshua Sobol
Wer weiß schon, ob das Leben Theater, die Welt eine Bühne ist? In der Welt des Theaters jedenfalls hält der Dramatiker die Fäden in der Hand, teilt jedem eine Rolle zu. Aber spätestens wenn der Vorhang fällt, ist der Schein durchbrochen. In seinem neuen Roman läßt Joshua Sobol, einer der bekanntesten Dramatiker Israels, im dunkeln, welche Rollen seine Figuren eigentlich spielen. Wo beginnt die Illusion, wo hört sie auf? Nicht einmal Chanina Regev selbst, Sobols Protagonist, könnte diese Frage beantworten. Chanina schon gar nicht. Er nennt sich mal Shakespeare, mal Shylock, ist Dichter, Whiskykenner und ein Star der New Yorker Werbeszene. Früher gehörte er einer Einheit des israelischen Geheimdienstes an, die Terroristen aufspürte und tötete. Eines Tages entdeckt er in einer Bar in Manhattan den Mörder zweier seiner Kameraden: Adonas, Tino der Syrer genannt, der, als wäre dies nicht genug, auch noch identisch ist mit dem skrupellosen Zuhälter Toni, aus dessen Fängen Chanina die New Yorker Prostituierte Winnie befreien will, Winnie, die sich Melissa, Timberlake oder Pipa nennt.
So weit, so gut und so verwirrend. Aber ist Chanina wirklich ein Auftragsmörder? Oder hat er sich diese abenteuerliche Geschichte, die in einer brutalen Verfolgungsjagd in der Wüste endet, bloß ausgedacht? Oder ist sein Leben gar ein Action-Film? Für Chanina, der sich als "Dichter der verlorenen Identität" ausgibt, löst sich die Wirklichkeit im Nebel auf. Chanina entzieht sich für den Leser jeder Festlegung. Nur ein einziges Mal tritt er aus der Deckung hervor, als er von seinen Eltern berichtet, die den Holocaust überlebt haben, als er von seiner schwer traumatisierten Mutter erzählt und dem emotional verhärteten Vater, der von allen der "Eisenmann" genannt wird. Als Junge vernichtete Chanina in seinen Tagträumen das Dritte Reich und verhinderte so auch den Holocaust. Aber in diesem Fall wären seine Eltern einander nicht begegnet, gäbe es keinen Chanina. Wohl oder über mußte er sich damit abfinden, daß sich das Böse nicht aus der Welt schaffen läßt.
Chanina bleibt an die Vergangenheit gekettet, doch wird nicht klar, ob in diesem Umstand auch die Ursache für seine zersplitterte Identität zu suchen ist. "Der Mensch ist ein Material, das jede Eigenschaft annehmen kann. Jede neue Begegnung erzeugt einen neuen Menschen, der bis zu jenem Augenblick nicht existiert hat." Nichts ist fragwürdiger als das Subjekt, und immer in diesem Roman trügt der Schein. Die Agentengeschichte dient als Camouflage einer problematischen Selbstsuche. Und Chanina, der wortgewaltige Erzähler, will im Grunde gar nicht so viele Worte machen: Er behauptet, er wäre gerne ein "Körper-Poet". Da er um die zerstörerische Kraft der Worte weiß, glaubt er, nur in der stummen Sprache der Gebärden Wahrheit und Einheit finden zu können. So gerät er freilich in das alte Dilemma, die Wortlosigkeit mit Worten zu beschwören. Dies erinnert wiederum an Sobols ersten Roman "Schweigen", der aus der Sprachverweigerung ein ganzes Erzähluniversum erstehen ließ. Chanina trägt sein kulturkritisches Klagelied jedoch allzu lärmend vor; zumal so manche Dialoge besser kürzer ausgefallen wären.
Sobol hingegen beweist nach "Schweigen" erneut sein Geschick als einfallsreicher Erzähler. Er flicht ein Netz der Identitäten, zerschneidet aber zuweilen die Fäden und läßt sie in der Luft baumeln. Routiniert, doch augenzwinkernd jongliert er mit Thriller-Elementen und philosophischen wie literarischen Anspielungen, mit Shakespeare-Verweisen wie mit der Metafiktionalität.
"Whisky ist auch in Ordnung" ist ein literarisches Rätsel von bewundernswerter Raffinesse, schwer zu entschlüsseln und voller falscher Fährten. Durch den kühlen Zungenschlag, mit dem es daherkommt, wird man nicht recht warm mit Chanina. "Niemand liebte Chanina", heißt es denn auch, und: "Er hatte nichts an sich, was Menschen gerne lieben." Blitzt hier der wahre Chanina auf, ein armer Kerl, der sich in Größenphantasien flüchtet? Oder setzt er sich nur geschickt als einsamer Wolf in Szene? Es spricht zwar für die Bravour des Autors, daß er beide Möglichkeiten offenläßt. Aber letztlich wünscht sich der Leser doch etwas mehr festen Boden unter den Füßen.
ANDREA NEUHAUS
Joshua Sobol: "Whisky ist auch in Ordnung". Roman. Aus dem Hebräischen übersetzt von Barbara Linner. Luchterhand Literaturverlag, München 2005. 317 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
In einer Doppelrezension bespricht Maik Söhler diesen Roman und den ihm aufs Verblüffendste ähnelnden Debüt seines Landsmanns und Schriftstellerkollegen Benny Barbasch, "Probelauf". Hier wie da geht es um einen erfolgreichen Werbetexter, in diesem Roman heißt er, abwechselnd, "Shylock" und "Shakespeare" und Nino. Er ist Mossad-Agent - in seiner Fantasie wohl nur, das macht der Rezensent aber nicht ganz klar, der Roman womöglich auch nicht. Dieser Held wird - mutmaßlich in seiner Fantasie - in eine Spionage-Geschichte verwickelt und hat Sex mit vielen schönen Frauen. Ausführlich zitiert Söhler, wie der Autor das beschreibt, überaus konventionell nämlich, nicht besser als sein Kollege Barbasch. Beide können also, sollte man wohl resümieren, so ungefähr die selben Dinge nicht, erzählen etwa, und schreiben. Sobol kommt die Ehre zu, noch ein bisschen schlechter zu sein als Barbasch: Das ist aber, daran lässt der Rezensent keinen Zweifel, auch schon egal.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH