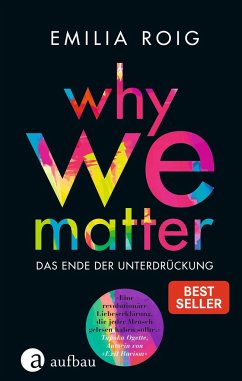Emilia Roig deckt die Muster der Unterdrückung auf - in der Liebe, in der Ehe, an den Universitäten, in den Medien, im Gerichtssaal, im Beruf, im Gesundheitssystem und in der Justiz. Sie leitet zu radikaler Solidarität an und zeigt - auch anhand der Geschichte ihrer eigenen Familie -, wie Rassismus und Black Pride, Trauma und Auschwitz, Homofeindlichkeit und Queerness, Patriarchat und Feminismus aufeinanderprallen.
"Radikal und behutsam zugleich. Dieses Buch ist ein heilsames, inspirierendes Geschenk." Kübra Gümüsay
"Die Antwort auf viele Fragen unserer unsicheren Zeit heißt: Gleichberechtigung aller. Und dieses großartige Buch ist ein Schritt auf dem Weg dahin."
Sibylle Berg
"Dieses Buch wird verändern, wie Sie die Welt wahrnehmen und Sie verstehen lassen, was Gerechtigkeit wirklich bedeutet."
Teresa Bücker
"Radikal und behutsam zugleich. Dieses Buch ist ein heilsames, inspirierendes Geschenk." Kübra Gümüsay
"Die Antwort auf viele Fragen unserer unsicheren Zeit heißt: Gleichberechtigung aller. Und dieses großartige Buch ist ein Schritt auf dem Weg dahin."
Sibylle Berg
"Dieses Buch wird verändern, wie Sie die Welt wahrnehmen und Sie verstehen lassen, was Gerechtigkeit wirklich bedeutet."
Teresa Bücker
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensentin Sonja Zekri ist bestürzt über die alten "Hierarchien, Entwertungen und verweigerten Chancen", die die Autorin aufzeigt und staunt über die Freundlichkeit, mit der Emilia Roig dennoch dazu aufruft, das Alte hinter sich zu lassen, da unter den herrschenden Verhältnissen immer auch die Täter-Seite leide. Die Forderungen der Autorin findet die Kritikerin radikal, oder auch naiv, jedenfalls aber ist sie beeindruckt von ihrer Fähigkeit, bei klarem Blick auf das vielfältige Opfersein auch die Privilegierung auszumachen, die fast jede auf die eine oder andere Weise gleichzeitig besitzt. Dass nicht Ausgrenzung und Trennung bei Roig herrschen, sondern ein "ozeanisches Miteinander" vorstellbar wird, überrascht die beeindruckte Kritikerin dennoch. In jedem Fall aber beurteilt sie dieses Buch als eine "gute Wahl" für alle, die sich mit dem Thema Diversität auseinandersetzen möchten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Alles eine Frage der Macht: Emilia Roig erörtert Gründe und Formen alltäglicher Diskriminierung
Stellen wir uns eine Mutter vor, die ihrem Sohn aus einem Buch vorliest. Der Vielfalt wegen ändert sie beim Lesen hin und wieder Namen und Geschlechter, so auch bei der Geschichte über den sechs Jahre alten Alexander den Großen, der das Pferd Bucephalus zähmt. Die letzte Zeile des Kinderbuches lautet: "Alexander, du wirst Großes vollbringen!" Die Mutter sagt: "Alexandra". Nach einer kurzen Pause will der Sohn wissen, ob es sich bei dem mutigen Kind wirklich um ein Mädchen handle. Aber sicher, sagt die Mutter. "Nicht für mich", urteilt ihr Sohn. "Für mich ist sie ein Junge."
Die Autorin und Aktivistin Emilia Roig beschreibt die Reaktion ihres Sohns als Ausdruck eines inneren Konflikts. Er will sich mit der Heldin identifizieren, aber kein Mädchen sein. Wäre er ein Mädchen, so Roig, und Alexander bliebe ein Junge, hätte das Kind die Frage nach dem Geschlecht mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gestellt. "Nicht nur Mädchen lernen, die Welt aus der Perspektive der Jungen zu betrachten", schreibt Roig. Nichtweiße Menschen lernen, sich in weiße Menschen hineinzuversetzen, Queere in Heteros. Die natürliche Abgrenzung ihres Sohns ist als Empathielücke bekannt. Die Vielfalt der ungleich verteilten Heldengeschichten als Intersektionalität.
Emilia Roig ist mit zwei Geschwistern in einem Pariser Vorort aufgewachsen. Ihre Mutter stammt aus Martinique, ihr Vater ist als Sohn eines Pied-Noir in Algerien geboren. Ihr Alltag, schreibt sie, war von Rassismus geprägt, auch weil die Eltern des Vaters aus der Hautfarbe der Kinder eine Art Fetisch machten und über andere nicht-weiße Menschen herzogen.
Obwohl sie sich schon früh zu anderen Frauen hingezogen fühlte, heiratete Emilia Roig einen Mann: "Seit meiner Kindheit habe ich verinnerlicht, dass Ehe und Kinderhaben keine Optionen sind, sondern unentbehrliche Etappen im Leben, ohne die eine Frau keine Erfüllung erfahren kann." Die Beziehung galt ihr als nötige Bedingung dafür, Mutter zu werden. Für den Erhalt des Gleichgewichts in der Ehe lernte sie, sich ahnungslos zu stellen, sich von ihrem Mann die Welt erklären zu lassen.
Roig ist 37 Jahre alt. Sie hat Jura und Politik studiert, wurde in Berlin promoviert, lehrt an Hochschulen in Frankreich, Deutschland und Amerika postkoloniale Studien, Völkerrecht, Intersektionalität und Critical Race Theory. Bevor sie ankam, wo sie sich jetzt befindet, hat sie unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen gemacht: als Queere, als Schwarze und als Frau. Sie lässt deshalb kein gutes Haar an den Machtmechanismen unserer Welt.
Ihr Buch zu lesen ist ein Test an den eigenen Empathielücken. Für eine heterosexuelle, weiße Leserin beginnt die Identifikation dort, wo Roig von den Erwartungen an sie als junge Frau berichtet, und endet mit ihrer Auflehnung gegen stereotype partnerschaftliche Rollen. Dann liest man von der Abwertung von Weiblichkeit, auf der Trans- und Homofeindlichkeit basierten, von der Hierarchie zwischen zwei konstruierten Geschlechtern, von unbewussten Vorurteilen.
Die Autorin führt ein Beispiel nach dem anderen an, wie etwa während des vierstündigen Urteilsspruchs nach den NSU-Morden und auf dreitausend Seiten Urteil kein Satz für die Familien der Opfer fiel. Nun, schreibt sie, werde sie die sozialen Hierarchien aufdecken, die dafür gesorgt haben, dass die Realität der einen als spezifisch und die der anderen als universell betrachtet werde.
Die Dichte, die Beweisführung, der instruktive Ton: "Why We Matter" ist eine anstrengende Lektüre. Wem gilt all das, denkt man, legt das Buch weg, fühlt sich belehrt: Sogar am Wohlfühlfilm "Ziemlich beste Freunde" hat Roig etwas auszusetzen. Alle Klischees über Klasse, Behinderung und schwarze Männer würden darin bedient, und eben weil er gesellschaftliche Ordnung erhält, berühre der Film so sehr.
Dann nimmt man das Buch doch wieder zur Hand und liest weiter, von der Angst der Privilegierten, sich eingestehen zu müssen, dass nicht alles in ihrem Leben durch Talent und harte Arbeit erkämpft ist, sondern Konsequenz einer gesellschaftlichen Bevormundung. Für diejenigen, bei denen solche Sätze ein Frösteln auslösen, für die Wegleger und Weiterleser, schreibt sie, und sie dürften in der Mehrzahl sein.
Roig greift ins Herz des Bildungssystems und zerrt an ihm. Sie beklagt das Fehlen postkolonialer und anderer kritischer Studien im Lehrplan, in der Literatur und Philosophie, vermisst eine weitere, nicht von weißen europäischen Männern artikulierte Perspektive auf die Welt. Warum lernten Kinder in Martinique und Guadeloupe alles über das europäische Mittelalter und nahezu nichts von der Sklaverei und der kolonialen Vorgeschichte ihrer Inseln? Bis der Löwe aus seiner Perspektive erzählt, so laute ein Sprichwort aus Simbabwe, werde die Erzählung von der Jagd immer den Jäger verherrlichen.
Im Dienst der gesellschaftlichen Umwälzung geht Roig sehr weit. Auch die im Verlauf der "Black Lives Matter"-Proteste entstandene Debatte über die Abschaffung der Polizei soll an dieser Stelle geführt werden, die Annahme entlarvt, Kriminalität habe mit mangelnder Disziplin und Pathologie zu tun. Wenn es heißt, New York sei sicherer geworden, bedeute das nicht Sicherheit für alle.
Ob die Entfernung des Räderwerks aber die Arbeit einer stinkenden alten Maschine verbessert? Es wäre Zündstoff für ein neues Buch. Und wenn sie anführt, die von ihr erklärte Ausnahmebehandlung der Schoa liege darin begründet, dass es sich um ein Verbrechen gegen weiße Menschen handle (hier sucht Roig Zuflucht in einem Zitat von Aimé Césaire), was wiederum eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Rassismus in Deutschland verhindere, hat das Frösteln einen anderen Ursprung. Dass Emilia Roig einen in seiner Radikalität essentiellen Beitrag zu den Diskriminierungsdebatten dieser Zeit geschrieben hat, steht außer Zweifel. Er wird es so lange bleiben, bis eine ganze Reihe weiterer Empathielücken geschlossen ist.
ELENA WITZECK.
Emilia Roig: "Why We Matter".
Das Ende der Unterdrückung.
Aufbau Verlag, Berlin 2021. 397 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Dass Emilia Roig einen in seiner Radikalität essentiellen Beitrag zu den Diskriminierungsdebatten dieser Zeitgeschrieben hat, steht außer Zweifel. Er wird es so lange bleiben, bis eine ganze Reihe weiterer Empathielücken geschlossen ist.« Frankfurter Allgemeine Zeitung 20210319