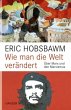Nicht lieferbar

Wie man die Welt verändert
Über Marx und den Marxismus
Übersetzung: Atzert, Thomas; Wirthensohn, Andreas
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Wer glaubt, Karl Marx sei tot, der irrt. Die Krise des kapitalistischen Systems hat neues Interesse an seinen Ideen geweckt. Eric Hobsbawm, seit seiner Jugend überzeugter Marxist, zeigt, was wir noch heute von Marx lernen können. Ein Leben lang hat sich der Historiker aus Großbritannien mit den Widersprüchen beschäftigt, die seit der Finanzkrise selbst liberale Ökonomen am Weltbild eines schlichten Kapitalismus zweifeln lassen. Hobsbawms neues Buch zeigt, wie der Marxismus in den letzten 150 Jahren die angeblich alternativlosen Regeln der kapitalistischen Wirtschaft in Frage gestellt und...
Wer glaubt, Karl Marx sei tot, der irrt. Die Krise des kapitalistischen Systems hat neues Interesse an seinen Ideen geweckt. Eric Hobsbawm, seit seiner Jugend überzeugter Marxist, zeigt, was wir noch heute von Marx lernen können. Ein Leben lang hat sich der Historiker aus Großbritannien mit den Widersprüchen beschäftigt, die seit der Finanzkrise selbst liberale Ökonomen am Weltbild eines schlichten Kapitalismus zweifeln lassen. Hobsbawms neues Buch zeigt, wie der Marxismus in den letzten 150 Jahren die angeblich alternativlosen Regeln der kapitalistischen Wirtschaft in Frage gestellt und widerlegt hat. In Hobsbawm hat Marx seinen souveränen Interpreten für das 21. Jahrhundert gefunden.