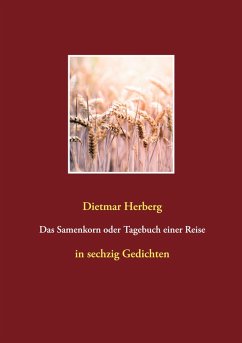Die Entstehungsgeschichte dieses postmodern anmutenden Textes ist einigermaßen komplex: Der 61jährige Miguel de Unamuno schrieb 1925 im selbstgewählten Exil in Paris eine Erzählung namens Wie man einen Roman macht, die er aber wegen der herrschenden Militärzensur nicht in Spanien veröffentlichen wollte, sondern 1926 in der Übersetzung von Jean Cassou in der Zeitschrift 'Mercure de France' publizierte, eingeleitet von einem Unamuno-Portrait aus der Feder Cassous. Zwei Jahre später denkt er doch an eine spanische Ausgabe (die dann auch 1927 erscheint, allerdings in Argentinien), die nun allerdings mehrfach gebrochen ist: mehr als die Hälfte des Buches besteht aus einem neuen Vorwort, dem erwähnten Portrait Unamunos und seinem Kommentar zu diesem Portrait, und der Text selbst ist nicht die Originalfassung, sondern Unamunos Rückübersetzung der französischen Fassung. Der ursprüngliche Essay aus den bitteren Jahren der Verbannung wird so zu einer einzigartigen Mischform aus Autobiografie, Tagebuch, Dialog und Reflexion über das Wesen von Literatur und realer Biografie.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Verneinungskette: Miguel de Unamuno preist das Unvollendete
Welche Energie, vor allem: welches Motiv muß jemand haben, um nicht aus äußerer, sondern aus innerer Notwendigkeit 11591 lange Seiten Sprache schriftlich und öffentlich aus sich herauszusetzen? Wer soll ihm auf dieses verbale Gebirgsmassiv folgen? Miguel de Unamuno (1864 bis 1936) scheint sich keine Illusionen gemacht zu haben. Unverblümt bekennt er, daß sein Werk immer dasselbe sei. Die Anlässe mögen im einzelnen wechseln, im Anliegen selbst bleibt er unbeirrbar seiner militanten Lebensfrömmigkeit treu. So kann auch das kleine Buch "Wie man einen Roman macht" von 1927 en miniature für das Ganze zeugen.
Unamuno liegt an einer klaren Botschaft provozierend wenig, um so mehr an der Bewegung der Boten. Oder anders gesagt: bloß nichts auf sich beruhen lassen. Wenn man stehenbleibt und der Eindruck entstünde, irgendwo anzukommen, dann heißt es "sich zu widersprechen und sich zu negieren". Denn, um es mit einem concetto zu sagen, das Unamuno selbst für eine sehr spanische Figur hielt (und wer wäre mehr Spanier als dieser Baske?): Er hatte eine konsequente Philosophie. Ihm war jedes Wort recht, das Widerstand gegen alle konsequente Philosophie leistet.
Sein Protest wurzelt in der einschneidenden Krise der Erkenntnistheorie Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Sie reicht bis hin zu Gott, so wie ihn sich "logostrunkene Metaphysiker" zurechtgelegt haben. Stein des Anstoßes bei allen Gedankengebäuden sind der Verstand und seine Neigung zur "Ideokratie": "Alles Rationale ist antivital." Es will alles nur auf ganze, große Geschichten reduzieren und fixieren und betreibt damit den Tod des Lebendigen. Wie klassisch modern das doch Kirchenväter der Postmoderne wie Derrida oder Lyotard erscheinen läßt.
In diesen gewaltigen, Spanien, die Geschichte, Gott und die Welt verschlingenden Kampf ist Unamuno gezogen. Man kann nicht gerade sagen, daß er dabei gering von sich gedacht hat. Umgekehrt war er jedoch ohne Rücksicht bereit, für sein Sendungsbewußtsein Entbehrung, Einsamkeit und Verbannung auf sich zu nehmen. Liegt es daran, daß sein - philosophischer - Lehrer Don Quijote war? Jeder Mißstand war ihm recht, um für die Überzeugung eine Lanze zu brechen, daß der Sinn des Lebens leben ist. Darin steht er gewiß dem élan vital seines Altersgenossen Henri Bergson nahe.
Was aber hieße "Leben" in dieser Umgebung des Denkens? Es läßt sich, darin ist Unamuno Modernist, bevorzugt negativ angeben. Das größte Ärgernis des Lebens, das nichts anderes will als weitergehen, ist der Tod. Von daher rührt "das unsterbliche Bedürfnis des Menschen nach Unsterblichkeit", wie er in seiner Grundschrift "Das tragische Lebensgefühl" auf seine spanisch-barocke Weise sagt. Der Tod, er ist deshalb im Wortsinne "das Vollendete, das Perfekte". Und seinen besten Handlanger findet er in menschlicher Verstandestätigkeit. Weil sie stets auf etwas Endgültiges, Definitives hinauswill, macht sie uns unmerklich zu lebendig Toten.
Wie läßt sich dagegen ein Sinn für Unsterblichkeit retten? Gewiß nicht durch irgendein Letztes, wie immer es heißen mag. "Der menschliche Roman hat kein Mark, keine Handlung." Wer ihm auf den Grund geht, endet im Gleichnis von den japanischen Lackschächtelchen, die in sich jeweils wieder ein anderes enthalten. Mit der Konsequenz, daß das letzte - leer ist.
Diese Nichtigkeit ist der bodenlose Grund, auf dem Unamuno seine Denk- und Sprachgebäude errichtet. Entsprechend fallen sie aus. Da sie für irgendeine Ewigkeit nicht gebaut sein können, kommt es darauf an, in ihnen eine nicht abreißende Kette von Verneinungen zu veranstalten, die sich gegen all das richten, was sich für unverbrüchlich, endgültig oder tausendjährig hält.
Wie aber könnte sich dieser moderne "Ritter von der negativen Gestalt" dadurch unsterblich machen? Nur wenn er stets unterwegs ist, außerhalb bleibt, auch um den Preis "höllischer Einsamkeit", fortlaufend die Leere zwar mit Fiktionen füllt, aber gegen ihre Windmühlen sogleich wieder vorgeht. Nur wer sich so mitten in die Gegensätze begibt, erfährt "die heilige, süße, erlösende Unsicherheit", wie es in "Das tragische Lebensgefühl" heißt. Sie erst macht frei für die Erfahrung des Lebens als etwas jetzt Stattfindendes. Einzig der Kampf mit den Zufälligkeiten, dem Kontingenten, dem Unfertigen des Augenblicks läßt merken, daß man mit dem Leben noch nicht fertig ist. Das ist die Unsterblichkeit, die Unamuno meint. Allzuweit entfernt bewegt sich Heidegger nicht, als er sich in den dreißiger Jahren aufmachte, "Holzwege" zu beschreiten. "Sie gehen", wird er zwar sagen, "in die Irre. Aber sie verirren sich nicht." Sie führen vielmehr ins "Unbegangene", das heißt zu den Quellen - des Lebens.
Bevorzugtes Gehwerkzeug ist die Sprache. Aber arbeitet sie nicht ihrerseits dem Tod, den Unamuno meint, in die Hände? Denn was sie auch tut, es läuft, wie schon der einzelne Satz zeigt, auf einen Schlußpunkt hinaus. Wie soll ein Medium mit soviel End-Bewußtsein Lebenselan vermitteln? Ohne geeignete Sprache wäre Unamunos antiphilosophische Philosophie also nichts wert. Auch diesem Problem muß er deshalb in seinem Buch nachgehen.
Ausgangspunkt ist seine Situation, während er sein Buch schreibt: ein Verbannter im (freiwilligen) Exil in Frankreich, unmittelbar an der Grenze zu Spanien. Wütend und leidend dringen seine Blicke und Gedanken über die Grenze und denunzieren die aufziehende Diktatur unter dem "Zuhälter" Primo de Rivera und seinen "epileptischen" Ministern. Er selbst stellt sich als "Türhüter" auf, der draußen bleibt, um sagen zu können, was die Zensur drinnen ungesagt macht: Er ist der Mann an der Grenze. Drüben herrscht, so übersetzt er seine Situation, eine diktatorische Vernunft. Und er verkörpert das Gegenspiel: mit Poesie heilsame Verwirrung in diese tote Ordnung zu bringen. Die Verbannung verleiht ihm die rechte Perspektive, adelt ihn zum "Rufer in der Wüste". Der "Allerweltsverstand", das ist das Hirngespinst, das dieser neue Don Quijote bekämpft, mit deutlichen Worten und unebener Schreibweise.
In diesem Sinne führt er auch seinen "Roman" ins Feld. Aber ist gerade er nicht auf Geschichten aus? Ein Roman der Verbannung kann daher in Unamunos Sicht nichts anderes als eine Verbannung des Romans sein. Und genauso fällt er auch aus: "Die beste Art, diesen Roman zu machen, besteht darin, zu erzählen, wie man ihn machen muß." Das sieht so aus: 1925, während seines Pariser Exils, hat er die Erzählung gleichen Titels geschrieben. Ein Freund übersetzte sie ins Französische und veröffentlichte sie. Jetzt, 1927, will er sie ins Spanische rückübersetzen. Sie wird dadurch, ihrerseits, zu einem Grenzübergang. Mit anderen Worten: Sie kann nicht so bleiben, wie sie ist. Ein Vorwort reflektiert sie; das "Porträt" des Übersetzers und Herausgebers kommt hinzu, das der Autor seinerseits bespricht. Der Text selbst wird regelmäßig mit Kommentaren durchbrochen; eine Fortsetzung hinzugefügt und diese wiederum durch Tagebucheinträge fortgesetzt; sie hört auf, ohne zu enden.
Die Erzählung, die nicht erzählt wird, ist dementsprechend. Würde sie geschrieben worden sein, wäre von einem die Rede, der bei einem Bouquinisten an der Seine einen Roman gekauft hat, ihn aber nicht zu Ende lesen darf - das würde auch sein Ende sein. Deshalb müßte es "der Roman seiner Lektüre eines Romans" werden. Die Funktion zumindest scheint klar: Er soll erklären, warum Unamuno seinen Roman der Verbannung nicht oder nur so, von einem Lackschächtelchen ins andere, schreiben konnte. "Mise en abyme" hat es André Gide im selben Jahr genannt. Eines kann fürs andere eintreten; das gerade macht es durchlässig für die Bewegung des Lebens. Ihm kommt es allein darauf an, etwas zu machen, nicht etwas zu sein.
Deshalb auch ist die eigentliche Lebensphilosophie dieser großen Gestalt der spanischen Geistesgeschichte im zwanzigsten Jahrhundert literarisch. Sie will dadurch das Philosophische an sich leugnen. Gut lesbar wird sie dadurch, zumal hier, gewiß. Gute Literatur allerdings war unter diesen Umständen nicht zu erwarten. Und wohl auch nicht beabsichtigt.
WINFRIED WEHLE
Miguel de Unamuno: "Wie man einen Roman macht". Aus dem Spanischen übersetzt von Erna Pfeiffer. Literaturverlag Droschl, Graz 2000. 136 S., br., 22,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Um die allerletzten Dinge scheint es in diesem Roman des 1936 verstorbenen spanischen Autors zu gehen, wenn man Winfried Wehle glaubt. Seine Kritik ist allerdings in einem derart hohen Ton geschrieben, dass man als gewöhnlicher Leser den Eindruck gewinnt, nicht ganz heranzureichen. Von Unsterblichkeit ist die Rede, vom Tod als das "Vollendete", das uns Lebende zu "lebendig Toten" macht, von der Krise der Erkenntnistheorie Ende des 19. Jahrhunderts und von Unamunos Kritik des Rationalen. Ob der Roman eine Handlung hat, wird aus der Kritik nicht eigentlich ersichtlich, man erfährt aber durch ein Unamuno-Zitat, dass die beste Art, diesen Roman zu schreiben, darin bestehe "zu erzählen wie man ihn machen muss". Es scheint sich im Vorgriff auf postmoderne Theorien um eine "Erzählung, die nicht erzählt wird", zu handeln, um eine schreibende Reflexion über das Schreiben von Literatur. Einen Trost hat Wehle aber parat: Unamuno scheint ein weit über elftausendseitiges Werk über diese Thematik verfasst zu haben, und Wehle verspricht, dass dieser kleine Text das ganze en miniature enthalte. Immerhin eine Zeitersparnis!
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH