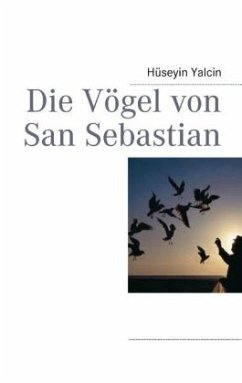Da stürzen in New York die Türme ein, und in einem Ferienbauernhof irgendwo in der Mitte Deutschlands verwandelt sich durch diese Weltkatastrophe eine empfindliche und gefährdete Liebesgeschichte urplötzlich in eine dumme Episode. Ganz leisegeschieht das. Und fast nie werden sie laut, die Figuren in Franziska Gerstenbergs Erzählungen. Es scheint sogar, als machten sie am liebsten einen großen Bogen um die Orte,an denen es in ihrem Leben vielleicht spektakulär oder tragisch zugehen könnte. Und doch vibriert es allenthalben, die Figuren zittern vor Unsicherheit. Sie ahnen, dass sie, obwohl nochganz jung, schon lauter ungelebtes Leben vor sich her schieben. Bald muss etwas geschehen. Aber da ist ja so viel Alltag! - unser noch nicht so ganz vereinigter bundesdeutscher Alltag.Nicht als Sammlung von Markenprodukten und Konsumentenoberflächen, Alltag vielmehr alsdas Muster der zarten Risse, die durch das Selbstverständnis der Figuren gehen.Franziska Gerstenberg zeichnet stille und eindringliche Porträts von Menschen um die zwanzig, die vom Mit-, Nach- und Gegeneinander der Lebens- und Gesellschaftsentwürfedurchdrungen und manchmal auch durchschnitten worden sind.

Die junge deutsche Literatur nach dem Ende des Jugendwahns: Franziska Gerstenbergs Debütband zeigt, daß es Geschichten gibt, die nur eine Fünfundzwanzigjährige erzählen kann
Leipzig, so weiß man nach der Lektüre dieses Buches, ist eine Stadt mitten in Deutschland. Der Unterschied zwischen den alten und den neuen Bundesländern, den seit der Wende zahllose literarische Werke beschrieben und vermessen, verflucht und beschworen haben, spielt in Franziska Gerstenbergs erstem Erzählungsband keine Rolle mehr. Das liegt weniger daran, daß diese Autorin in Leipzig gelebt und studiert hat, sondern hängt vor allem mit dem Zeitpunkt ihrer Geburt zusammen. Als die DDR in sich zusammenstürzte, war Franziska Gerstenberg zehn Jahre alt: zu jung, um zu verstehen, was vor sich ging, aber alt genug, um es zu erahnen. Alt genug, um den Unterschied zwischen Ost und West zu kennen, aber zu jung, um ihn als ewige Bürde mit in die Zukunft schleppen zu müssen. Während vielen Älteren das Jahr 1989 heute erscheinen mag, als wäre es erst gestern gewesen, meldet sich hier die Vertreterin einer neuen literarischen Generation zu Wort. Wenn 1989 erst gestern war, dann waren die Angehörigen dieser Generation gestern noch Kinder.
Die meisten Figuren in den fünfzehn Geschichten, die dieser Band versammelt, haben ungefähr das Alter der Erzählerin, aber einige sind auch deutlich jünger. Daniel etwa, vierzehnjähriges Einzelkind, bewohnt mit seinen Eltern eine Doppelhaushälfte, deren Gegenstück lange Zeit unbewohnt war. Die Lage an der Hauptstraße sei schuld am Leerstand, sagt die Mutter und deutet auf den Garten, in dem blasse Salatköpfe wachsen, deren Blätter nach Benzin schmecken. Der Vater hält die fehlende Garage für ausschlaggebend. Irgendwann muß sich das Fehlen der Nachbarn als sozialer Makel bemerkbar gemacht haben, und mit kleinsten Andeutungen gibt Franziska Gerstenberg zu verstehen, daß es nicht der einzige war, der dieser Familie zu schaffen macht. Jetzt ziehen endlich neue Nachbarn ein, Menschen mit italienisch klingendem Namen aus einem fernen Ort namens Wiesbaden. Das Seltsamste aber an den Donellas ist ihr Sohn Anton, ein großer, reichlich ungeschlachter Junge in Daniels Alter, der beim Grillen Brot und Gemüse links liegenläßt und lieber Fleischberge vertilgt. Anton ist ausgesprochen wortkarg, nur ab und zu macht er überhaupt den Mund auf: "Ich bin der Carlos, sagt er dann laut und mit Nachdruck, der Carlos Santana bin ich. Er schwingt sein weißes Taschentuch, bevor er hinzufügt: Der echte, der aus Mexiko!"
Wie Anton sind die meisten Figuren in diesem Buch nicht ganz von dieser Welt. Oder besser gesagt: Sie leben mehr oder weniger eingesponnen in ihren Mikrokosmos. Die zwanzigjährige Praktikantin, die in der Suppenküche für Obdachlose arbeitet, die grobknochige Schwester der kleinen Ballerina, die heimlich Ballettunterricht nimmt, obwohl sie zu alt und zu schwer dafür ist, die siebzehnjährige Lisa, die sich im Chaos ihres Kinderzimmers vor dem Gefühlschaos in ihrem Inneren versteckt oder die nur wenig ältere Hannah, die sich fast alles vorzustellen vermag, aber im Lexikon unter dem Stichwort "Realismus" nachschlagen muß, wenn sie wissen will, worin eigentlich der Unterschied zwischen Imagination und Wirklichkeit besteht - sie alle sind Geschwister jenes geistig behinderten Anton Donella, der auf einem gestohlenen Kinderfahrrad ausbüxt und sich auch den Polizisten, die ihn aufgreifen, als Carlos Santana vorstellt, der echte, der aus Mexiko.
Auch Daniel, der mit dem Opernglas seines Großvaters am Fenster die Nachbarn beobachtet, fühlt sich Anton viel näher, als seine Eltern ahnen: "Ich ziehe die Schuhe aus und laufe durchs Grünkohlbeet. Wenn sich meine Zehen in die feuchte Erde eingraben, entstehen schmatzende Geräusche. Vielleicht stehen Vater und Mutter am Fenster und sehen auf mich herunter. Dann wird Vater fragen, woran es liegt, daß ich keine Freunde habe. Ich trete einen Strunk Grünkohl um, ohne den Blick zu heben, aber das Fenster bleibt geschlossen. Ich überlege, was geschieht, wenn ich so, mit diesen Füßen, zu Vater und Mutter hinaufgehe und ihnen sage, daß Anton Donella mein bester Freund ist. Ich könnte sagen: Ich gehe ihn suchen. Ich könnte den Stadtplan mitnehmen oder Vaters Kompaß. Ohne Anton Donella, könnte ich sagen, komme ich nicht zurück."
Daniel bricht nicht auf, um seinen Freund zu suchen. Er bleibt, wenn man so will, mit beiden Füßen im Grünkohl stecken. Der Ausbruchsversuch ist nur ein Gedankenexperiment, das in der Wirklichkeit keine größeren Folgen als einen trotzig, ängstlich, mißmutig zertretenen Grünkohlstrunk. Wenn Daniel älter sein wird, zwischen zwanzig und fünfundzwanzig vielleicht, wird er wohl ebensooft und leichthin aufbrechen und reisen wie die anderen Figuren dieses Bandes. Oft sind sie allein unterwegs, wie etwa der Tramper, der sich einem trostlosen Trio anschließt, aber in Gedanken ganz bei seinem daheimgebliebenen Freund ist, oder die Urlauberin aus der Stadt, die eine Affäre mit der Bauerstochter beginnt.
Munter wird hier die Geschlechteridentität gewechselt, ohne daß der Frage, ob die Ich-Erzählerin nun gerade mit einem Mann oder mit einer Frau unglücklich ist, allzu großes Gewicht zukäme. Franziska Gerstenberg schlüpft aus Neugierde und Experimentierlust in verschiedene Erzählerfiguren, und deutlich ist zu sehen, daß sich hier eine junge Autorin erprobt und Perspektiven testet. Wo andere Debütanten gern ihre Muskeln spielen lassen, tastet sich Franziska Gerstenberg vorsichtig voran, zart beinahe und doch zielgerichtet, kontrolliert und reflektiert. So entgeht die Fünfundzwanzigjährige jener Falle, in die in den letzten Jahren so viele junge deutsche Autoren mit ihren Erzählungsbänden tappten. Denn allzuoft entstand durch die monoton gehandhabte Ich-Perspektive der Eindruck vor allem autobiographisch geprägten Erzählens, der den vom sogenannten "Fräuleinwunder" geprägten Jugendwahn des Literaturbetriebs bald in den Generationsüberdruß münden ließ.
Die Situation hat sich grundlegend geändert: Während vor drei, vier Jahren Erstlingswerke wie Meisterwerke gehandelt und auch bezahlt wurden, erfolgt der Einstieg in den Literaturbetrieb nun unter dramatisch verschlechterten Bedingungen. Das liegt nicht nur an der schwierigen ökonomischen Lage der Buchbranche, sondern hat sicherlich auch mit der Beliebigkeit zu tun, mit der junge Autoren in die Verlagsprogramme gehievt wurden. Jetzt droht das Pendel zur anderen Seite auszuschlagen, und die Gefahr ist groß, daß junge Talente wie Franziska Gerstenberg der allgemeinen Debütantenmüdigkeit zum Opfer fallen. Aber, so könnte man fragen, was wäre daran eigentlich so schlimm?
Um Mißverständnissen vorzubeugen: Jugend ist keine literarkritische Kategorie, und Junggenies wie Büchner oder Trakl sind zur Zeit nicht in Sicht. Aber in einer Gesellschaft, die einerseits die Jugend mit ungeheurem Aufwand künstlich bis zur Pensionsgrenze zu verlängern versucht und andererseits keine klare Vorstellung mehr davon besitzt, was Kindheit bedeutet, die einerseits ihren Nachwuchs nicht früh genug in einen oft gnadenlosen Erwerbs- und Verwertungsprozeß jagen kann und andererseits das lebenslange Bürgerrecht auf Infantilität kodifiziert, die einerseits kaum Fünfzigjährige aus dem Berufsleben zu verbannen trachtet und andererseits gebannt die Memoiren knapp Dreißigjähriger verfolgt - kurzum, in einer Gesellschaft, die zu den Komplexen Jugend und Alter ein so offenkundig bis ins Mark gestörtes Verhältnis hat, muß sich die Literaturkritik - unabhängig von allen Trends und Konjunkturen - das Interesse an jungen Autoren bewahren. Denn das Beispiel Franziska Gerstenbergs zeigt, daß es Perspektiven auf unsere Gesellschaft gibt, wie sie nur von jungen Autoren eingenommen werden können.
Für viele Ältere im Land ist die Wiedervereinigung welthistorischer Glücksfall, unvermeidliche Geschichtskorrektur oder wirtschaftspolitisches Desaster. Wie auch immer die Wiedervereinigung empfunden werden mag, in jedem Fall markiert sie eine oft unverhoffte, fast immer unerwartete Zäsur. Jana Hensel und jetzt auch Peter Richter, drei und sechs Jahre älter als Franziska Gerstenberg, haben in ihren literarischen Sachbüchern "Zonenkinder" und "Blühende Landschaften" ebenjene Zäsur zum Thema gemacht: Die eine Hälfte ihres jungen Lebens verbrachten sie in der DDR, die andere im wiedervereinigten Deutschland. Deshalb ist ihnen, kaum dreißigjährig, die eigene Existenz bereits historisch geworden. Franziska Gerstenberg siedelt ihre Erzählungen an Orten an, die weder dem westlichen noch dem östlichen Teil des Landes eindeutig zugeordnet werden können. Sie hat einen anderen Weg gewählt, und es mag sein, daß der Altersunterschied von wenigen Jahren zu dieser Entscheidung nicht wenig beigetragen hat.
Für die Generation der kaum mehr als Zwanzigjährigen ist das wiedervereinigte Deutschland der Normalfall. Sie blicken heute auf die DDR zurück, wie ein Fünfundzwanzigjähriger 1960 auf das "Dritte Reich" zurückgeblickt haben mag. Sie bilden die erste Generation, die einen von der früheren Teilung nahezu unberührten Blick auf das heutige Deutschland haben kann. Gleichzeitig war diese Generation jedoch völlig anderen Einflüssen ausgesetzt als ihre Vorgänger. Die Ölkrise und die wachsenden ökologischen Probleme trugen in den siebziger Jahren wesentlich dazu bei, daß die Grünen Züge einer überparteilichen Jugendbewegung annehmen konnten. Wer 1980 zwanzig Jahre alt war, mußte seine gesamte Teenagerzeit über das Wort vom Waldsterben wie einen basso continuo hören. Den heute Zwanzigjährigen dröhnt der Schädel von der Rentenreform, der Altersarmut, den ökonomischen Folgekosten der deutschen Einheit, Begriffen, die wie ein Tinnitus im Ohr sitzen. Ganz zu schweigen vom 11. September.
Franziska Gerstenbergs Erzählung "Glückskekse" erzählt von einem Urlaubsabenteuer zwischen zwei Frauen, der sechzehnjährigen Marianna, die auf dem Urlauberbauernhof ihres Vaters als Köchin und Zimmermädchen arbeiten muß, und der deutlich älteren Erzählerin. Beide sind in einer gegenläufigen Fluchtbewegung begriffen. Die Erzählerin flieht in die Abgeschiedenheit, Marianna sieht in der Urlauberin die Chance, der dörflichen Enge und dem verhaßten autoritären Vater zu entfliehen. Als die Dörfler von der Affäre erfahren, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch der Vater dahinterkommt. Die Katastrophe scheint unausweichlich. Aber sie kommt anders als gedacht: "Sie sah zum Bildschirm, öffnete und schloß den Mund, ihre Zähne glänzten weiß. Irgendwo schlug eine Uhr, und plötzlich dachte ich, Marianna ist häßlich, ein häßlicher Fisch, ihr Mund ging auf und zu. Vielleicht lag es am flackernden Fernsehlicht, an den Menschen, die sechstausend Kilometer von uns aus geborstenen Fenstern sprangen, vom Wind durch die Luft getrieben wurden wie Fetzen von Zeitungspapier, oder daran, daß Marianna, als sie nach langer Zeit sprach, nur ein einziges Wort sagte: Cool."
Danach zerrt der Vater, verstört und außer sich, die Tochter aus dem Zimmer, Türen schlagen, Stimmen überschlagen sich, und die Erzählerin muß es mit keinem Wort mehr aussprechen, daß ihr erotisches Abenteuer nun vorüber ist: "Sie zeigten die Aufnahmen in einer Endlosschleife, die professionellen und auch die Amateurvideos, spielten dazu getragene Musik, ich drehte den Ton ab, blieb aber sitzen. Vielleicht kochte Marianna das Abendessen, sie hatte von gebratener Entenkeule gesprochen, obwohl das ein Sonntagsgericht war." Der letzte Satz der Erzählung gilt einem Blick in den Himmel: "Immerhin hatte es aufgehört zu regnen."
Von allen Wörtern, die mit "Himmel" beginnen, interessiert Franziska Gerstenberg wohl jenes am wenigsten, das mit "Richtung" endet. Der Himmel ist nicht mehr geteilt über Leipzig, der Stadt irgendwo in Deutschland: Er ist grau, soweit das Auge reicht. Grau, so weiß man nach der Lektüre dieses Buches, ist eine Farbe, die in vielen Facetten zu schillern vermag.
Franziska Gerstenberg: "Wie viel Vögel". Erzählungen. Verlag Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2004. 230 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Junggenies wie Büchner oder Trakl sind zur Zeit nicht in Sicht, schreibt Hubert Spiegel, aber dieser Debütband der 25-jährigen Leipziger Autorin Franziska Gerstenberg hat es ihm doch so angetan, dass er ihm den Aufmacher der Frühjahrsbeilage widmet. Hier könne man mitverfolgen, wie eine junge Autorin verschiedene Perspektiven ausprobiere. Sie "tastet sich vorsichtig voran, zart beinahe und doch zielgerichtet", lobt Spiegel. Gerstenberg hat ihm gezeigt, dass bestimmte Perspektiven auf unsere Gesellschaft nur von jungen Autoren eingenommen werden können. Für ihre Generation sei das wiedervereinigte Deutschland bereits der Normalfall, lesen wir. Die Erzählungen selbst, von deren intensiver Atmosphäre Spiegel einiges vermitteln kann, sieht er an Orten angesiedelt, die weder Ost- noch Westdeutschland zugeordnet werden können. Der Himmel über diesem ungeteilten Land ist grau, schreibt Spiegel, doch dies ist eine Farbe, die "in vielen Facetten schillern" kann, lernt der von Gerstenberg.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"»Ein exzellentes Debut mit poetisch genauen Momentaufnahmen aus dem neuesten Deutschland, jenen dürftigen Lebenszonen, in denen die Grenzen zwischen Ost und West bereits verwischt sind.«Franz Haas, Neue Zürcher Zeitung»Hut ab, was für ein Talent, was für ein Versprechen.«Uwe Wittstock, Literarische Welt»Wo andere ihre Muskeln spielen lassen, tastet sie sich vorsichtig heran, zart beinahe und doch zielgerichtet.«Hubert Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung»Die junge Autorin zeigt, daß sie das Unheimliche nicht nur anstrebt, sondern es einzusetzen versteht.«Verena Auffermann, Die Zeit»Ich liebe ihr Debüt für (...) schrägen Figuren, die mit so viel Ruhe und Zurückhaltung gezeichnet sind, daß sie die Vorstellungskraft ganz schön auf Touren bringen.«Brigitte»Sie ist eine Meisterin kleiner, perfider Rochaden, die sie oft schon in den Eröffnungssätzen der Erzählungen versteckt.«Meike Fessmann, Der Tagesspiegel»Der neue Star am Literaturhimmel.«die tageszeitung» Es sind kühle, sachliche Geschichten, die trotz mancher Komik ein Unbehagen provozieren und einen auch nach dem Lesen nicht zur Ruhe kommen lassen.«Jan Brandt, taz Magazin»Sie schafft es, schon nach wenigen Seiten den Leser zu fesseln, denn ihre Geschichten besitzen eine kunstvolle, aber ganz ungezwungene Leichtigkeit.«Ralf Schneider, Frankfurter Neue Presse»Gerstenberg hat mit diesem Band ein Gesellenstück vorgelegt, das von präzisen Momentaufnahmen lebt, die da einsetzen, wo die DDR aufgehört hat.«Karim Saab, Märkische Allgemeine»Ein Talent schreibt sich nach vorn - Franziska Gerstenberg dringt an den Kern der kleinbürgerlichen Lebensart vor und denunziert sie maßvoll.«Hessische/Niedersächsische Allgemeine»Ein Buch, das viel vom Leben erzählt.«Gala»Ein großartiges Debüt über das Dilemma der Postpubertät (...) - mit einer knappen Sprache, wie in Stein gemeißelt.«Woman»Einfach faszinierende Geschichten: "Wie viel Vögel",das Debüt von Franziska Gerstenberg bei Schöffling & Co.«Ulrich Faure, BuchMarkt»Gegenwärtig, innovativ, eindringlich.«Kreuzer»Franziska Gerstenberg kann tolle erste Sätze schreiben, von denen man im Nachhinein begreift, dass sie an sich schon eine ganze Geschichte erzählen.«Frankfurter Rundschau»Franziska Gerstenberg taucht tief unter die Oberfläche.«MDR»Gerstenberg beherrscht souverän das lakonische Erzählen in der Tradition Judith Hermanns und Peter Stamms.«Paul Brodowsky, WDR 3, Mosaik»Stilsicher schlüpft die 24jährige Autorin in verschiedene Rollen. Geschichten mit Widerhaken.«Prinz»Leichthändig hingeworfene Porträts von Menschen, deren Leben am Wendepunkt ist.«Christoph Schröder, Journal Frankfurt»Franziska Gerstenbergs Anfänge sind meisterhaft. Ganze Schicksale können sich in einer Satzpause abzeichnen, ganze Lebenswege können in einemNachsatz verschwinden.«Bayerischer Rundfunk»Den Namen Franziska Gerstenberg wird man sich merken müssen.«Hamburger Abendblatt"