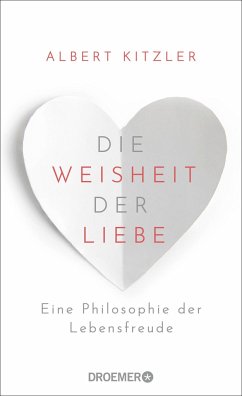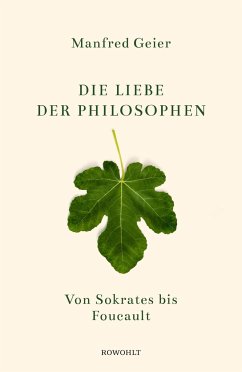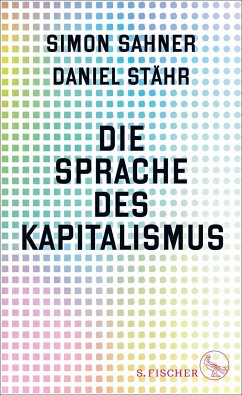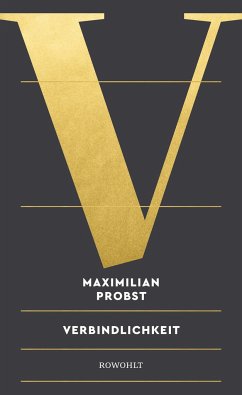-48%12)

Wie wir die Welt verändern (Mängelexemplar)
Eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes
Illustration: Harjes, Stefanie
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Gebundener Preis: 21,00 € **
Als Mängelexemplar:
Als Mängelexemplar:
10,89 €
inkl. MwSt.
**Frühere Preisbindung aufgehoben
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Bestseller-Autor Stefan Klein nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch die Geschichte des schöpferischen Denkens. Von den Innovationen der Steinzeit wie Malerei über die Erfindung der Schrift bis hin zu den Leistungen der Computer von morgen zeigt Stefan Klein anschaulich und unterhaltsam, wie der Geist immer wieder neu die Welt verändert hat. Wir begegnen Neandertalern und Steve Jobs, Leonardo da Vinci und Ada Lovelace, Archimedes und AlphaZero. Dabei wird deutlich: Innovation und Fortschritt verdanken wir nicht den Einfällen einsamer Genies - sie entwickeln sich im geistigen Austausc...
Bestseller-Autor Stefan Klein nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch die Geschichte des schöpferischen Denkens. Von den Innovationen der Steinzeit wie Malerei über die Erfindung der Schrift bis hin zu den Leistungen der Computer von morgen zeigt Stefan Klein anschaulich und unterhaltsam, wie der Geist immer wieder neu die Welt verändert hat. Wir begegnen Neandertalern und Steve Jobs, Leonardo da Vinci und Ada Lovelace, Archimedes und AlphaZero. Dabei wird deutlich: Innovation und Fortschritt verdanken wir nicht den Einfällen einsamer Genies - sie entwickeln sich im geistigen Austausch. Denn Kreativität, Phantasie und Innovation sind keine individuellen Talente, sondern entstehen zwischen den Menschen.
Wie wurde unsere Welt die, in der wir leben? Wie wurden wir, was wir sind? Und wie geht es weiter? Jede Veränderung beginnt mit einer neuen Idee! Packend erzählt der renommierte Wissenschaftsautor von der Macht der Gemeinschaft, der Zukunft des Denkens und den unbegrenzten Möglichkeiten unserer Kreativität.
Wie wurde unsere Welt die, in der wir leben? Wie wurden wir, was wir sind? Und wie geht es weiter? Jede Veränderung beginnt mit einer neuen Idee! Packend erzählt der renommierte Wissenschaftsautor von der Macht der Gemeinschaft, der Zukunft des Denkens und den unbegrenzten Möglichkeiten unserer Kreativität.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.