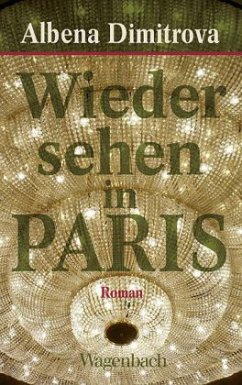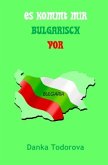In einem Land, wo es auf einmal Südfrüchte aus Kuba gibt, weil Fidel Castro unsterblich in eine bulgarische Sängerin verliebt ist, wo Silber und Kristall, Samt und Champagner den obersten Regierungskadern vorbehalten sind und Straßenkinder mit Schokolade für die Partei geködert werden, lernt die kaum siebzehnjährige Alba in einem Elitekrankenhaus den viel älteren Guéo kennen.
Guéo ist Mitglied des Politbüros und hat unter anderem als "Einraucher" für den erkrankten Regierungschef gearbeitet, als der nicht mehr selbst rauchen durfte ... Die Begeisterung des ungleichen Paares füreinander ist groß und rein platonisch: Es wird stundenlang vorgelesen, geraucht und diskutiert. Als schließlich beide entlassen werden, gelingt es Guéo, Alba mit seinem Sohn zu verkuppeln, doch das geht nicht lange gut. Stattdessen werden sie schließlich selbst ein Liebespaar, immer versteckt, sich dabei immer beobachtet wissend. Die Welt um sie herum verändert sich. Guéo arbeitet fieberhaft an einem Reformprogramm zur Rettung des Kommunismus, aber heimlich träumen beide von einem gemeinsamen Abendessen in Paris.
Albena Dimitrova erzählt von einer unmöglichen Liebe in einem unmöglich gewordenen System. In vielen originellen Szenen und lapidaren Beobachtungen entführt ihr Roman bilderreich in eine untergegangene Welt und entlarvt mit dem Irrsinn der damaligen auch den Irrsinn heutiger Werte.
Guéo ist Mitglied des Politbüros und hat unter anderem als "Einraucher" für den erkrankten Regierungschef gearbeitet, als der nicht mehr selbst rauchen durfte ... Die Begeisterung des ungleichen Paares füreinander ist groß und rein platonisch: Es wird stundenlang vorgelesen, geraucht und diskutiert. Als schließlich beide entlassen werden, gelingt es Guéo, Alba mit seinem Sohn zu verkuppeln, doch das geht nicht lange gut. Stattdessen werden sie schließlich selbst ein Liebespaar, immer versteckt, sich dabei immer beobachtet wissend. Die Welt um sie herum verändert sich. Guéo arbeitet fieberhaft an einem Reformprogramm zur Rettung des Kommunismus, aber heimlich träumen beide von einem gemeinsamen Abendessen in Paris.
Albena Dimitrova erzählt von einer unmöglichen Liebe in einem unmöglich gewordenen System. In vielen originellen Szenen und lapidaren Beobachtungen entführt ihr Roman bilderreich in eine untergegangene Welt und entlarvt mit dem Irrsinn der damaligen auch den Irrsinn heutiger Werte.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Originell, intensiv und hochgradig reflektiert nennt Judith von Sternburg diesen Roman der französisch-bulgarischen Autorin Albena Dimitrova. "Wiedersehen in Paris" erzählt von einer Amour fou zwischen der Siebzehnjährigen Alba und dem 53-jährigen Politbüromitglied Guéo, die - bis zur dramatischen Trennung - gemeinsam das Ende des Kommunismus und die große Zeitenwende in Bulgarien erleben. Die Kritikerin Dimitrova zieht dabei alle Register ihres schriftstellerischen Temperaments, freut sich Sternburg, mal erzähle sie nüchtern, mal elegisch und manchmal brillant. Gut gefallen haben der Rezensentin auch die Einsichten der Autorin in opportunistische Systeme. Guéos am Ende enthüllten Plan zur Rettung des Kommunismus hält Sternburg gar für einen echten "Hammer".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Bulgarische Kommunismusnachwehen: Albena Dimitrovas Roman "Wiedersehen in Paris" über den Zerfall von Politik und Privatleben
Geheimdienst und Liebe, das ist eine spannende Konstellation, davon weiß nicht nur James Bond ein Liedchen zu singen - heiße Emotionen im Kalten Krieg. Doch jenseits des Films beginnen andere Realitäten: Vertrauensverlust, extremes Misstrauen, Traumatisierung für den getäuschten Partner. George Orwells "1984" ist auch in dieser Hinsicht aufschlussreich. Heute erleben wir dies schon auf eher alltäglichen Ebenen, wenn Lover ihre Videos ins Netz stellen, eine Art schleichende Diktatur durch Technik. Und nichts ist sich aus Prinzip feindlicher als das überwache Gehirn totalitärer Herrschaft und das Geheimste am Menschen.
Das muss zu eisigen Abstürzen in Beziehungen führen, und so geschieht es mit der Liebe in Albena Dimitrovas "Wiedersehen in Paris". Alba, noch Schülerin, an einem Bein gelähmt, lernt im Sanatorium einen Mann kennen, der nicht nur verheiratet ist. Guéo ist auch Parteifunktionär und schreibt an seinem abschließenden Lebenswerk, einem Gutachten über die Reform des Kommunismus, einem Werk, an dem er zerbrechen wird. Wir sind in Bulgarien am Ende der achtziger Jahre, alles geht drunter und drüber, man hört das langsam zerfallende Gebälk in einem morschen Haus. Dazu werden Vorgeschichten erzählt, in denen sich frühe Risse ankündigen - doch durch Risse dringt, wie wir von Leonard Cohen wissen, auch Licht.
Eine Zeitlang versucht der Geliebte, sie mit seinem Sohn zu verkuppeln, um sie enger an sich zu binden. Doch das endet in einer blutigen Prügelei, der Alba nur mit Mühe entkommt: "Ich hatte den Mund voller Blut, einen ausgeschlagenen Backenzahn und ein Herz in Freiheit." Danach hat sie eine Abtreibung zu überstehen, auch das ein Ergebnis des Liebens im "Nirgendwo der Schicksale", im Limbo zwischen Kommunismus und einer unbekannten Welt, die sich gerade zu öffnen beginnt. Der Moment des Zeugens ist tief in ihrer Erinnerung vergraben, symbolisch aufgehoben in allen sinnlichen Einzelheiten jenes Wintertags, vom Staub in einem Zimmer bis zum Glatteis vor der Tür.
Am Horizont aber leuchtet allen Emigranten, ob Kommunisten oder Staatsfeinden, eine Stadt als Hoffnungsstern: Paris. Die selbst dort lebende Albena Dimitrova, eine Französisch schreibende bulgarische Autorin, verarbeitet auf ganz individuelle, oft poetische - wenn auch manchmal gestelzte - Art Übergänge zwischen Systemen, wie sie sich in der großen, aber auch verlorenen Liebe der Erzählerin mit dem Funktionär spiegelt.
Schattenhaft tauchen Randfiguren auf, die geheimdienstlich zentral sind. Der bulgarische General in Frankreich etwa, der mit seinem phantastischen Französisch, das dem achtzehnten Jahrhundert abgelauscht scheint, an den rumänischen Philosophen Émile Cioran erinnert, denn auch dieser pflegte solch ein "in Paris unauffindbares Französisch" und kultivierte "nachlässig-elegante Wörter". Oder der polyglotte Diplomat, der zu kommunistischen Zeiten Botschafter in Rom war, ein Kenner der frühen italienischen Malerei, und jetzt Nachtwächter ist und Nachhilfeunterricht für die Kinder von Neureichen gibt - einer von vielen postkommunistischen Lebensläufen. Auch dessen Französisch ist makellos, eine "in Form gebrachte Freiheit". So wird die Sprache Frankreichs zum utopischen Ort. Aber sie bleibt lange im Nirgendwo, denn das erste Wörterbuch der Erzählerin ist veraltet, es stammt aus dem Jahr 1947, und die Definitionen decken sich nicht mehr mit der Realität. Utopie ist halt ein veraltetes Spiel, das nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat.
Das ist schließlich die mühsame Erkenntnis, die Guéo in seinem "Gutachten zur Reform des Kommunismus", erarbeitet, das dem Buch als Anhang, sozusagen als Ausbruch aus der Fiktion, beigegeben ist. Der Parteimensch glaubt noch an einen dritten Weg, in dem das Gute des alten Systems in der Dynamik des neuen aufgehoben wäre. So notiert er am 16. November 1988: "Wir müssen das Kollektiveigentum an den Produktionsmitteln erhalten und unser politisches System stärken. Dieser Weg, den manche den ,dritten' nennen, ist der richtige Weg in die Zukunft." Diesen dritten Weg wird er selbst nicht mehr erleben, denn kurz nach Vollendung des Gutachtens wird sich der Autor des Manifests umbringen, als wisse er, dass Politik, die den Kontakt zur Realität verloren hat, dem Untergang geweiht ist.
Die Erzählerin hadert unterdessen mit sich, mit ihrer Liebesgeschichte, ihrem Körper, mit allem, was sie als Person bedingt, und sie fragt sich immer wieder: Woran ist der Kommunismus gescheitert? Vielleicht ähnelte das Geschehen einer scheiternden Liebesbeziehung? Eine der Antworten jedenfalls lautet, er habe sich zwar um materielle Besitzfragen gekümmert, aber nie wirklich verstanden, die Herzen zu erobern. Und das könnte damit zusammenhängen, dass der Kommunismus "zuerst mal seinen eigenen Wunsch nach dem Kommunismus abgetötet" habe. In solchen Teufelskreisen bewegt sich ein politisch-poetischer Roman, der immer Blitzlichter aufscheinen lässt - wie wenn Reporter in die Pathologie eindringen und neues Wissen über einen verstorbenen Prominenten an die Öffentlichkeit durchgeben. Keine kleine Kunst von Albena Dimitrova, daraus einen Roman zu machen, der die menschliche Seite einer politischen Katastrophe so anschaulich macht.
ELMAR SCHENKEL
Albena Dimitrova:
"Wiedersehen in Paris".
Roman.
Aus dem Französischen
von Nicola Denis.
Wagenbach Verlag,
Berlin 2016. 189 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main