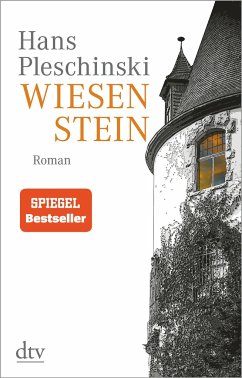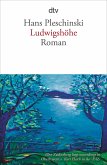Der letzte Akt im Leben des großen Gerhart Hauptmann
Der berühmte alte Mann, Nobelpreisträger, verlässt mit seiner Frau das Sanatorium in Dresden und wird mit militärischem Begleitschutz zum Zug gebracht. Doch es ist März 1945; Gerhart und Margarete Hauptmann möchten zurück nach Schlesien, in ihre Villa 'Wiesenstein', ein prächtiges Anwesen im Riesengebirge. Dort wollen sie ihr luxuriöses Leben weiterleben, in einer hinreißend schönen Landschaft, mit Zofe, Butler und Gärtner, Köchin und Sekretärin - inmitten der Barbarei. Können sie aber noch unbehelligt leben, jetzt, da der Krieg verloren ist, russische Truppen und polnische Milizen kommen? Und das alte Schlesien untergeht?
Der berühmte alte Mann, Nobelpreisträger, verlässt mit seiner Frau das Sanatorium in Dresden und wird mit militärischem Begleitschutz zum Zug gebracht. Doch es ist März 1945; Gerhart und Margarete Hauptmann möchten zurück nach Schlesien, in ihre Villa 'Wiesenstein', ein prächtiges Anwesen im Riesengebirge. Dort wollen sie ihr luxuriöses Leben weiterleben, in einer hinreißend schönen Landschaft, mit Zofe, Butler und Gärtner, Köchin und Sekretärin - inmitten der Barbarei. Können sie aber noch unbehelligt leben, jetzt, da der Krieg verloren ist, russische Truppen und polnische Milizen kommen? Und das alte Schlesien untergeht?

Der letzte große Geist des deutschen Geniekults: Hans Pleschinski erzählt das Leben des Dramatikers Gerhart Hauptmanns
Mit dem Roman "Königsallee" hatte Hans Pleschinski 2013 großen Erfolg. Eigentlich ging es nur um eine Nebensache: Thomas Manns "letzte Leidenschaft" beim fiktiven unverhofften Wiedersehen mit einem Geliebten. Wie unversehens aber ließ die Kunst des witzigen und geschichtsbewussten Erzählers auch das Lebensgefühl der frühen Bundesrepublik erstehen.
Nun legt Hans Pleschinski einen Roman über Gerhart Hauptmann vor, den anderen Anwärter auf den Thron des deutschen Dichterkönigs im zwanzigsten Jahrhundert. Ein Gegenstück zu "Königsallee" konnte daraus aber nicht werden, dazu sind die Voraussetzungen zu verschieden. Thomas Manns Ruhm als Romancier wie als politisch engagierter Akteur der europäisch-amerikanischen Geschichte strahlt nach wie vor hell. Dagegen wurde in Hauptmanns Fall schon anlässlich der zum 150. Geburtstag 2012 von Peter Sprengel vorgelegten Biographie gefragt, ob der Dichter nicht schon weitgehend vergessen sei.
Unzweifelhaft ist Hauptmann als Autor im Habitus des deutschen Geniekults längst historisch geworden. Den meisten Jüngeren ist der Name nicht mehr geläufig. Das schmälert Hauptmanns Verdienste nicht. Manchen Avantgardisten hat der Schimmel noch früher ereilt. Ein Dramatiker muss für das Publikum seiner Zeit schreiben, wenn er Erfolg haben will, und das wollte Hauptmann zweifellos.
Hans Pleschinski hat angesichts dieser Lage der Rezeption ein Verfahren entwickelt, das historische Distanz kenntlich machen soll, gleichzeitig aber Vergegenwärtigung ermöglichen. Das zeigt sich bereits in dem verblüffenden ersten Satz der Erzählung. "Der Opel Blitz kroch über die Mordgrundbrücke." Der Erzähler schildert den einstmals legendären Krankentransporter als ein Dingsymbol, an dem die raumzeitliche Ausgangssituation entfaltet wird. Das Gefährt ist notdürftig instand gesetzt, mangels Benzin läuft es mit einem Holzvergaser.
Es ist März 1945, und Deutschland ist am Ende. Der Wagen ist mit Sondergenehmigung der Gauleitung von Pirna nach Dresden gekommen, um einen berühmten Mann abzuholen. Einer der jungen Fahrzeugführer kennt ein Drama des Dichters, "Die Weber"; für seine Mutter, so berichtet er, ist der Nobelpreisträger "der letzte große Geist Deutschlands". Etwas von solcher Verehrung, wenngleich nicht ohne kritische Töne, erkennt der Leser von vornherein in Hans Pleschinskis Text.
Gerhart Hauptmann und seine Frau Margarete haben sich einer Kur in einem noblen Sanatorium unterzogen. Währenddessen wurde Dresden zerstört, aus Schlesien hat die Flucht eingesetzt. Trotzdem wollen die Hauptmanns unbedingt dorthin zurück, in ihre Villa im Riesengebirge. So führt sie der Weg durch das ganze grausame Elend in Schlesien, über einen "mit Leichen gedüngten Boden", den Pleschinski in beinahe barocker Fülle beschreibt.
Dabei gerät die Handlungsführung zeitweise außer Proportion. Zu gewaltig erscheint die Kulisse im Verhältnis zu denen, die nach Hause wollen. Daher könnte es so scheinen, als sollte den exzentrischen Hauptmanns das Bedürfnis nach gutem Leben als Schuld drastisch vor Augen geführt werden.
Empörte Schuldzuweisung ist aber so wenig Pleschinskis Absicht wie eine neue Deutung der Rolle Hauptmanns im Nationalsozialismus. Es bleibt bei dem Motivkomplex der partiellen Übereinstimmung mit nationalsozialistischer Ideologie, der mythisch unterlegten Heimatbindung und des Opportunismus aus Sorge um den Lebensstandard. Auf der anderen Seite aber steht ein Werk, das den Nazis gar nicht passte und auch eine wie immer heimliche Verweigerung des Mitmachens.
Gegen jede Wahrscheinlichkeit erreichen die Hauptmanns ihr Anwesen, eigentlich eher eine "Schutz- und Trutzburg", gebautes Rückzugsbedürfnis. Der als Dramatiker der Unterschicht berühmt und vermögend wurde, führte hinter dicken Mauern ein aristokratisches Leben mit Dienstboten und strenger Etikette, zum Diner hatten die Gäste Abendkleidung zu tragen.
Zum Charakter dieser Villa Wiesenstein gehört auch die Lage in der schlesischen Landschaft. Hauptmanns mythisch aufgeladenes Landschaftserlebnis, in dem jeder Grashalm das Deutsche repräsentiere, spielte zweifellos auch eine Rolle bei seiner Entscheidung, Deutschland nicht zu verlassen. Nicht zufällig hat der Erzähler von Manns "Doktor Faustus" die Romantisierung der Landschaft als bedenklichen vernunftwidrigen Zug des deutschen Wesens beschrieben. Zu Recht nennt Pleschinski den Roman "Wiesenstein": In dem Haus spiegelt sich umfassend Hauptmanns feierliches Lebensgefühl, in dem sich eine mythische Siegesgewissheit mit Angst vor der Welt paaren konnte. Seine letzten Worte vor seinem Tod im Juni 1946 sollen gelautet haben: "Bin ich noch in meinem Haus?"
Pleschinski erzählt die Geschichte des "liebend irrenden" Dichters mit offensichtlicher Entdeckerfreude, gerade was das mythisch beseelte Spätwerk angeht. Daran will er den Leser in langen Zitaten teilhaben lassen, wofür der Erzählanlass oft künstlich geschaffen wird. Auch wollte er nicht darauf verzichten, aus den unveröffentlichten Tagebüchern der Hauptmanns zu zitieren. Auch war es Pleschinskis Ehrgeiz, die Figurenrede weitgehend aus authentischen Dokumenten zu entwickeln, die einmontiert oder in wörtlicher Rede nachgeahmt werden bis hin zum Stottern des Dichters. Das klingt dann gelegentlich ziemlich hölzern. Bei der Kürze der erzählten Zeit, nur etwas mehr als Hauptmanns letztes Jahr, musste schließlich die Möglichkeit für die Episoden aus dem früheren Leben Hauptmanns in manchmal recht konstruiert wirkenden Zusammenkünften von Nebenfiguren je neu geschaffen werden.
Die gewählte Konzeption fordert also dem Leser einiges an Konzentration und Geduld ab und beeinträchtigt die Lesbarkeit und Flüssigkeit der Erzählung, die Pleschinskis Bücher bisher ausgezeichnet hat. Der Roman basiert auf einer gewaltigen Recherche- und Energieleistung, und der Leser wird Respekt davor haben, dass Pleschinski es sich in der Rekonstruktion von Hauptmanns Welt und Zeit nicht einfach gemacht hat. Im Übrigen gibt es in "Wiesenstein" viele Episoden, in denen man den gewitzten, warmherzigen und unterhaltsamen Erzähler Hans Pleschinski wiedererkennt.
FRIEDMAR APEL
Hans Pleschinski:
"Wiesenstein".
Roman.
Verlag C. H. Beck, München 2018. 552 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main