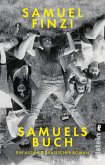In diesem kleinen israelischen Café mitten in Berlin herrscht immer bunter Trubel. Während die Gäste ihren Hummus mit Pinienkernen löffeln und die Pitabrote im Ofen köstlichen Duft verbreiten, hat die kleine Familie schon wieder alle Hände voll damit zu tun, den Alltag zwischen den Kulturen zu managen: Mal will ein ambitionierter Rabbi Kirsten ungefragt zum Judentum konvertieren, dann wünscht sich Töchterchen Miri nach dem Kindergarten eine neue Hautfarbe, und schließlich schlägt der graue Berliner Winter auch noch den Gatten in die Flucht. Sie sind oft komisch, manchmal schockierend und immer überraschend - die Geschichten aus dem Leben einer ganz normalen deutsch-israelischen Familie.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
"Über ihre deutsch-israelische Familie hat Kirsten Grieshaber ein aufrichtiges, humorvolles Buch geschrieben." Thorsten Schmitz, Süddeutsche Zeitung "Grieshaber schildert die anstrengende Realität spannungsreicher Koexistenz als ein Gewinn im Millimeterbereich." Jamal Tuschick, DER Freitag