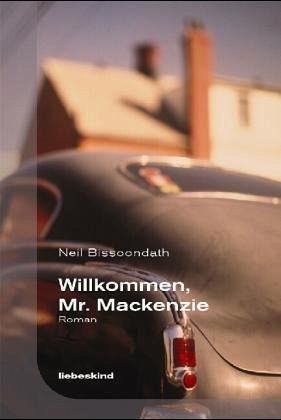Geschichten über Freundschaft und Liebe, über Vergangenheit und Erinnerung: In seinem Roman "Willkommen, Mr. Mackenzie" zeichnet Neil Bissoondath ein bewegendes Bild des Lebens, humorvoll und hintersinnig, voller Melancholie und Hoffnung. Alistair Mackenzie, emeritierter Professor für englische Literatur, lebt seit dem Tod seiner Frau allein. Zu seiner Tochter Agnes hat der eigensinnige Witwer ein gespanntes Verhältnis. Als sein Haus bei einem Feuer zerstört wird, ist er jedoch gezwungen, bei ihr und ihrer Familie einzuziehen. Mackenzie hat es nicht einfach, sich in seiner neuen Umgebung zurechtzufinden, und flüchtet in Erinnerungen an frühere Jahre. In Gedanken läßt er Menschen vorüberziehen, die seinen Weg kreuzten oder sein Leben teilten. Er erinnert sich an seine Schwester, die mit einem Zirkusakrobaten durchbrannte, an seinen Schwager, der hoch über den Wolken auf einem Flugzeugflügel spazierenging, an den Gärtner, der für seinen Nachbarn zum Mörder wurde ... und an seine Frau Mary, die er ein Leben lang liebte und beinahe für immer verloren hätte. Kunstvoll verknüpft Neil Bissoondath verschiedene Episoden zu einem faszinierenden Roman über einen Mann, der alles hinter sich lassen mußte, um endlich bei sich selbst anzukommen.

In Wattebausch und Bogen: Neil Bissoondaths zweiter Roman
Neil Bissoondath ist indischer Abstammung und darüber hinaus der Neffe von V.S. Naipaul. Damit hat er immerhin einen Literaturnobelpreis in der Familie sowie eine schier unerschöpfliche Literaturtradition im Rücken. So etwas kann für einen Autor schon einen gewissen Druck darstellen. In seinen bisherigen Büchern hatte er diesem insofern nachgegeben, als er stets das für ihn offensichtliche Thema "Immigration" behandelte. Sein zweiter Roman auf deutsch versucht nun, ganz auf dem kanadischen Neuland Fuß zu fassen.
Wieder geht ein kultureller Riß durch sein Buch, doch diesmal nicht zwischen indischer Ferne und nordamerikanischer Realität, sondern entlang der Sprachgrenze, die den kleineren franko- vom großen anglophonen Teil Kanadas trennt. Der Erzähler Alistair Mackenzie ist ein schwerhöriger emeritierter Literaturprofessor, der notgedrungen bei seiner Tochter einzieht, nachdem sein Haus wegen der Fahne eines Nachbarn abgebrannt wurde. Geblieben sind ihm nichts außer einer Schachtel voll Medaillen aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Schlafanzug, aus dem sich der Rauchgeruch nicht mehr herauswaschen läßt, und die Erinnerungen an ein langes Leben.
Als Englischprofessor mit der Vorliebe für Dickens und der Starrhalsigkeit des Alters versucht Mackenzie, das Vorhandensein der französischen Sprache in Kanada zu ignorieren, selbst im zweisprachigen Haushalt seiner Tochter. Den Schwiegersohn Jacques nennt er konsequent Jack, und sein Enkelkind spricht er auf englisch an, auch wenn es auf französisch antwortet. Diese Spannung, die Bissoondath, der englisch schreibt und französisch lehrt, ebenfalls aus eigener Erfahrung kennt, taucht zwar immer wieder auf, allerdings nur in einer Nebenrolle. Seine Geschichten erzählt Bissoondaths Hauptfigur mit menschlicher Wärme und der richtigen Ausgewogenheit von Glaubhaftigkeit und Skurrilität. Wie der eigentlich ziemlich unsympathische Mackenzie immer wieder fast gegen seinen Willen zu stillen und klugen Erkenntnissen gelangt, das entspricht sicherlich ganz dem verräterisch zweideutigen Originaltitel "Doing the Heart Good". Leider wirkt das alles nicht überzeugend, angefangen von den hölzernen Dialogen bis zu den überdeutlich symbolhaften Anekdoten und Figuren. Muß die Schwester Mackenzies ausgerechnet mit einem radschlagenden Zirkusartisten durchbrennen?
Vor allem aber gelingt es nicht, den Leser nachhaltig gefangenzunehmen. Mackenzie ist seit einer Kriegsverletzung fast taub, und es ist, als würde sich der Hörgeräteffekt auch beim Leser einschleichen, er nimmt die Wirklichkeit des Romans, so wie der Erzähler sie ihm vermittelt, wie durch Watte wahr. Vielleicht hat Bissoondath das gemerkt und setzt deshalb immer wieder auf Schockeffekte, die sich nur schwer in den Rest des Erzählten einfügen lassen. Denn neben den lebensklugen Einsichten möchte der Autor auch noch den Einbruch des Schreckens in die Normalität des kanadischen Alltags zeigen. Doch seine Geschichten von fernen Grausamkeiten, von Leid und Tod auf den europäischen Schlachtfeldern verkommen zu schaurigen Märchen. Es mag geschmacklos erscheinen, über Szenen wie jene, in denen serbische Soldaten mit dem Kopf eines Mädchens Fußball spielen, künstlerisch zu urteilen, aber indem Bissoondath ihnen sprachlich nicht gerecht wird, degradiert er sie zum Effekt.
SEBASTIAN DOMSCH
Neil Bissoondath: "Willkommen, Mr. Mackenzie". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Sylvia Morawetz. Liebeskind Verlag, München 2004. 351 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Hat sich der indischstämmige Autor Neil Bissoondath in seinen bisherigen Romanen mit dem Thema der Immigration beschäftigt, dreht sich sein vorliegendes Buch um den sprachlichen Riss im franco-anglophonen Kanada, stellt Sebastian Domsch fest. Bissoondaths Hauptfigur, der emeritierte Professor für englische Literatur und erklärter Charles-Dickens-Liebhaber Alistair Mackenzie, verweigert sich nämlich der Zweisprachigkeit und beharrt konsequent auf dem Englischen, erklärt der Rezensent. Wenn er auch zunächst meint, der Autor schildere seinen Protagonisten mit einnehmender "Glaubwürdigkeit und Skurrilität", sieht er sich schon bald von den allzu "hölzernen Dialogen" und der "überdeutlichen" Symbolik des Romans abgeschreckt. Zudem schaffe es Bissoondath nicht, seine Leser wirklich "gefangen zu nehmen", was auch durch die "Schockeffekte", die er allenthalben einbaut habe, nicht erreicht werde, beklagt sich der Rezensent. Die Intention des Autors, neben "lebensklugen" Einsichten Mackenzies, auch die Schrecken des Krieges und die Grausamkeit in die kanadische Alltagswelt eindringen zu lassen, misslingt nicht zuletzt deshalb, weil Bissoondath dem "sprachlich nicht gewachsen" ist und damit das Grauen zum bloßen "Effekt degradiert", moniert Domsch.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH