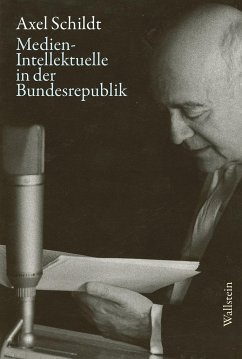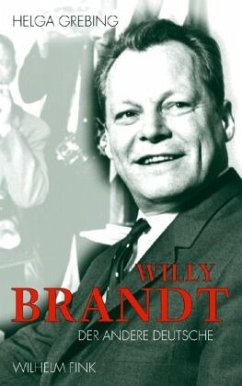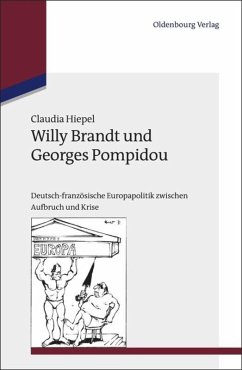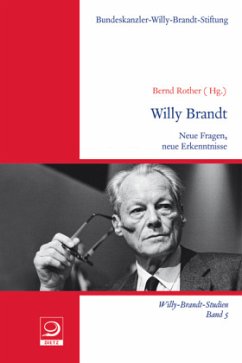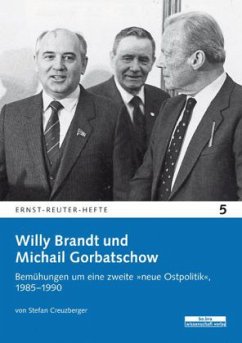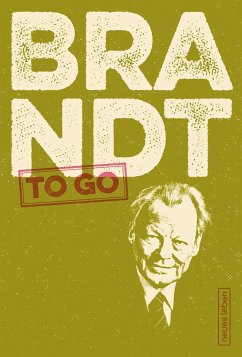Willy Brandt und die "Vierte Gewalt"
Politik und Massenmedien in den 50er bis 70er Jahren. Habilitationsschrift
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
35,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Nicht zuletzt dank der medienwirksamen Auftritte von Bundeskanzler Schröder wird das Verhältnis von Politik und Massenmedien derzeit viel diskutiert. Zentral ist dabei die Frage nach der "Macht der Medien" und der "Medialisierung der Politik". Daniela Münkel zeigt, dass sich das Verhältnis von Politik und Massenmedien bereits in den ersten Nachkriegsjahrzehnten bedeutend verändert hat. Sie schildert die Abhängigkeiten und vielschichtigen Beziehungsgeflechte zwischen Politikern, Journalisten und Verlegern seit den 50er Jahren. Im Mittelpunkt ihrer Studie steht Willy Brandt - der erste "mo...
Nicht zuletzt dank der medienwirksamen Auftritte von Bundeskanzler Schröder wird das Verhältnis von Politik und Massenmedien derzeit viel diskutiert. Zentral ist dabei die Frage nach der "Macht der Medien" und der "Medialisierung der Politik". Daniela Münkel zeigt, dass sich das Verhältnis von Politik und Massenmedien bereits in den ersten Nachkriegsjahrzehnten bedeutend verändert hat. Sie schildert die Abhängigkeiten und vielschichtigen Beziehungsgeflechte zwischen Politikern, Journalisten und Verlegern seit den 50er Jahren. Im Mittelpunkt ihrer Studie steht Willy Brandt - der erste "moderne Medienkanzler" in der Geschichte der Bundesrepublik. Er praktizierte in neuartiger Weise eine großzügige Informationspolitik, eine an der Wirkungsweise der Medien ausgerichtete Politikdarstellung sowie die mediale Inszenierung der eigenen Person. Sein "Kniefall von Warschau", ein Bild, das aus dem visuellen Repertoire der Bundesrepublik nicht mehr wegzudenken ist, ist das eindringliche Symbol dieser neuen Symbiose zwischen Politik und Medien.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.