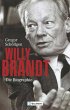Nicht lieferbar
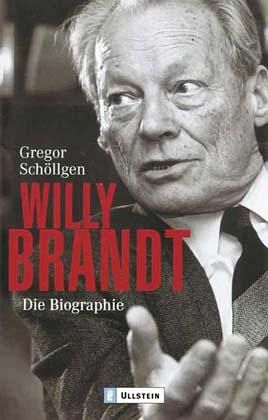
Willy Brandt
Die Biographie
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Willy Brandt hat vieles erlebt: Gestolpert und gestürzt ist er über Gegner und Neider, über Frauen und Spione und nicht zuletzt über sich selbst. Doch gescheitert ist er nicht: Willy Brandt war einer der bedeutendsten und zugleich populärsten Kanzler der Bundesrepublik. Mit dieser ersten großen Brandt-Biographie schuf der Historiker Gregor Schöllgen ein einzigartiges Porträt des Menschen und eine kritische Würdigung des Politikers Willy Brandt.
Willy Brandt war einer der bedeutendsten und zugleich populärsten Kanzler der Bundesrepublik. Wie nur wenige hat er das politische Klima in unserem Land geprägt.
Mit dieser ersten großen Biographie gelang dem Historiker Gregor Schöllgen ein einzigartiges Porträt des Menschen und eine kritische Würdigung des Politikers Willy Brandt.
Mit dieser ersten großen Biographie gelang dem Historiker Gregor Schöllgen ein einzigartiges Porträt des Menschen und eine kritische Würdigung des Politikers Willy Brandt.