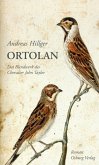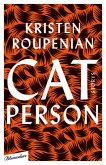Er ist ein fremder Gast unter Palmen, am Meer, in einer Stadt, in der immer die Sonne scheint, und das ist sein Unglück. Jan Wilm ist ein perspektivloser Philologe, der aus dem deutschen Wissenschaftsbetrieb ausgeschieden ist und - um die Arbeitslosigkeit hinauszuzögern - ein fremdfinanziertes Forschungsjahr in Los Angeles verbringt. Der Gegenstand seiner Untersuchung ist - ausgerechnet in Kalifornien - Schnee.
Wilm soll durch die Jahreszeiten hinweg den Nachlass des verschollenen Schnee-Fotografen Gabriel Gordon Blackshaw (1898 1950) sichten. Doch wie ein Buch über Schnee schreiben an einem Ort, an dem es nie schneit? Wie eine verlorene Frau vergessen, die einen an die Heimat bindet, weil man sie noch lieben muss und nicht vergessen möchte?
Verlust, Selbstverlust, Tod und Verortung in der Welt - wie lässt sich dafür eine Sprache finden, die gleichzeitig archiviert und auslöscht? Jan Wilms Roman unternimmt diesen Versuch. So meisterlich wie neu erweitert er die Möglichkeiten von Literatur, weist eindringlich in die Zukunft und zeigt dabei immer die Schultern der literarischen Riesen, auf denen wir stehen.
Wilm soll durch die Jahreszeiten hinweg den Nachlass des verschollenen Schnee-Fotografen Gabriel Gordon Blackshaw (1898 1950) sichten. Doch wie ein Buch über Schnee schreiben an einem Ort, an dem es nie schneit? Wie eine verlorene Frau vergessen, die einen an die Heimat bindet, weil man sie noch lieben muss und nicht vergessen möchte?
Verlust, Selbstverlust, Tod und Verortung in der Welt - wie lässt sich dafür eine Sprache finden, die gleichzeitig archiviert und auslöscht? Jan Wilms Roman unternimmt diesen Versuch. So meisterlich wie neu erweitert er die Möglichkeiten von Literatur, weist eindringlich in die Zukunft und zeigt dabei immer die Schultern der literarischen Riesen, auf denen wir stehen.
»Die mich immer faszinierende, aber so gut wie unbeachtete Arbeit des kalifornischen Schnee-Fotografen Gabriel Gordon Blackshaw erfährt in Jan Wilms »Winterjahrbuch« eine bewegende und außerordentlich interessante Würdigung.«Christian Kracht

Von dunklem Blau ins tiefste Schwarz: Jan Wilms "Winterjahrbuch" ist ein zitatreicher Monolog über den Schnee - und Jan Wilm. Man sollte wissen, worauf man sich mit dieser Lektüre einlässt.
Dieses Buch, so viel steht schon einmal fest, ist das dunkelste, traurigste Buch, das die deutschsprachige Gegenwartsliteratur in diesem Jahr bislang hervorgebracht hat. Der erste Satz lautet: "Die Träume sind tot, es gibt nur noch gestern." Und der letzte: "Wenn die Männer . . . kommen, um mit ihren Flammenwerfern den Schnee wegzutauen, dann könnten sie mich gleich mit fortbrennen, und es passierte niemandem ein Unglück." Wenn dieser Roman auf seinen mehr als 450 Seiten eine Entwicklung nachzeichnet, dann ist es eine Entwicklung in Nuancen, nämlich von einem dunklen Blau in ein tiefes Schwarz, vom Gehenlassen aller Hoffnungen in einen lebensverachtenden Nihilismus. Man sollte wissen, worauf man sich mit dieser Lektüre einlässt - es wird ja auch bald Herbst.
Jan Wilm, der als Literaturwissenschaftler, Kritiker und Übersetzer arbeitet, ist nicht bloß der Autor dieses Buches (seines Romandebüts übrigens), sondern auch sein Erzähler. Eine knausgårdische Beglaubigungsgeste verbindet sich damit aber nicht: Das Ich wird in diesem Buch als sprachliche Hervorbringung betrachtet, weshalb das leibhaftige und das literarische Ich ein Kontinuum zwischen Fakt und Fiktion bilden. Der Erzähler schildert diese Auffassung ganz unaufgeregt, was daran liegen mag, dass sie zum intellektuellen Grundbestand der Moderne gehört: "Ich hätte mich manchmal gern gefragt, ob ich anders leben könnte als in Sprache, als in einer einzigen Ich-Sprache." Anders im Ton, aber kaum im Gehalt, haben es schon Nietzsche, Hofmannsthal und Rilke formuliert.
Der Roman erzählt von einem Jahr im Leben des Jan Wilm, einem "Philologen", wie er sich selbst bezeichnet, der in Los Angeles ein Buch über den Schnee schreiben will. Die Grundlage hierfür soll der im Getty Center archivierte Nachlass des Schnee-Fotografen Gabriel Gordon Blackshaw sein - eine durch und durch enigmatische Künstlerfigur. Zugleich gibt es aber auch persönliche Gründe für den Aufenthalt in Kalifornien, nämlich einerseits das Ende einer Liebesbeziehung, das es in der Ferne zu überwinden gilt, und andererseits die bevorstehende Arbeitslosigkeit in Deutschland, die sich durch den Forschungsaufenthalt noch etwas hinauszögern lässt.
Während seiner Zeit in L.A. gelingt es Jan Wilm eher selten, sich ins Getty aufzumachen, wo er dann unkoordiniert in den Blackshaw-Papieren herumforscht. Die meiste Zeit verbringt er einsam und gelangweilt in seiner "Casita" mit Netflix und Bier. Und dann gibt es noch einige Frauen, die sich auf ihn einzulassen bereit sind, eine von ihnen sogar ernsthaft, also über das Sexuelle hinaus, von dem in diesem Buch häufig und explizit, bisweilen auch ekelästhetisch die Rede ist.
In diesen rudimentären Erzählrahmen sind ausführliche Reflexionspassagen eingefügt, die aus dem "Winterjahrbuch" streckenweise einen Ideenroman machen. In ihnen geht es um alles Mögliche, vor allem aber um die für den Erzähler höchst prekären Fragen nach der Liebe und der Erinnerung, nach der Sprache, dem Schreiben und der Wissenschaft, die sich eiskristallartig mit dem Leitmotiv des Schnees verbinden. Das klingt dann beispielsweise so: "Menschen, die Menschen mit Schneeflocken vergleichen, haben keine Achtung vor Menschen und keine Ahnung von Schneeflocken. Ich bin wie eine Schneeflocke? Ich bin wahrscheinlich nicht einmal wie ich."
Die Gedanken, die Jan Wilm umtreiben, stehen allesamt unter dem - wiederum modernistischen - Vorzeichen des Es-geht-nicht-mehr. Wie sollte man noch schreiben können, wenn man der Sprache nicht zutraut, die Wirklichkeit zu repräsentieren? Wie ließe sich noch Literaturwissenschaft betreiben, wenn die Philologie doch meist nur uninteressantes "Gerede" hervorzubringen vermag? Gerade hinter dieser Frage verbirgt sich eine Haltung, die man als akademischen Antiakademismus bezeichnen kann. In ihr verbinden sich Skepsis gegenüber der Wissenschaft und sogar Verachtung mit dem nachdrücklichen Anspruch auf Teilhabe am Wissenschaftssystem, so etwa in Gestalt eben jenes Stipendiums, das dem Erzähler seinen Aufenthalt in L.A. allererst ermöglicht. Halbironisch versieht er jede Erwähnung des ihm zugestandenen Geldes mit dem Kommentar "God love it" - ein Zitat aus Kurt Vonneguts "Slaughterhouse Five", wo der Satz auf das "Guggenheim money" des Ich-Erzählers bezogen ist.
Aus dem geplanten Schnee-Buch ist folglich keine philologische Studie, sondern - darin besteht die selbstreferenzielle Pointe - der vorliegende Roman geworden. In ihm zieht Jan Wilm die ästhetischen Konsequenzen aus seinen sprach-, subjekt- und wissenschaftskritischen Überlegungen. Das zeigt sich unter anderem darin, dass die Sprache in diesem Buch in ihrem Problemcharakter ständig mitreflektiert wird. Außerdem versucht der Roman, die Grenzen zwischen Philologie und Literatur konsequent zu verwischen. Die Gewährsleute hierfür sind Roland Barthes, auf den der Erzähler häufig zu sprechen kommt, aber vermutlich auch Maggie Nelson, deren poetisch-philosophische Umkreisungen der Farbe Blau im vergangenen Jahr auf Deutsch erschienen sind, und zwar in einer vielgelobten Übersetzung von Jan Wilm.
Formal äußert sich die wissenschaftlich-literarische Grenzverschiebung in einer wahren Überschüttung der Leser mit gelehrten und poetischen Äußerungen zum Themenkomplex Schnee, die manchmal vom Erzähler ausgelegt werden, oft aber auch unkommentiert bleiben. Zudem ist jedem Textabschnitt ein Songtitel vorangestellt, der nicht nur als Motto dient, sondern darüber hinaus als Empfehlung für eine entsprechende Begleitmusik. Spotify macht's möglich: Wer mag, kann sich dort eine - vornehmlich mit wehmütiger Americana bestückte - Playlist zum "Winterjahrbuch" aufrufen.
Angesichts der ausufernden Fülle an Zitaten und Verweisen fällt auf, dass Jan Wilm eine der naheliegendsten Schnee-Passagen der modernen Literatur in seinem Roman nicht erwähnt. Oder haben wir im Zitatgewimmel etwas übersehen? Möglicherweise liegt es ja daran, dass sich Hans Castorp in seinem Schneetraum eine Perspektive eröffnet, die im Widerspruch steht zu jenen "herrenlosen Tiefen" des "Selbstmitleids", in denen sich der Erzähler windet und verkrampft. Dass es am Einzelnen selbst liegen könnte, "um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einzuräumen über seine Gedanken" - wäre es nicht reizvoll gewesen, den Erzähler zumindest versuchsweise mit dieser bejahenden Kerneinsicht des "Zauberberg" zu konfrontieren? Eine dergestalt widerstreitende Position scheint das "Winterjahrbuch" aber nicht vorzusehen, wodurch es, trotz seiner überbordenden Zitathaftigkeit, etwas monomanisch Selbstbeschränktes hat. Das Dunkle, Traurige dieses zumutungsreichen, in seiner heftigen Negativität aber auch fesselnden Buches - es resultiert aus der Gefangenschaft des Intellektuellen in sich selbst.
KAI SINA
Jan Wilm:
"Winterjahrbuch". Roman.
Verlag Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2019.
455 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Kai Sina kann nur warnen vor dem Roman von Jan Wilm, derart finster geht es darin zu, derart hemmungslos wirft der Autor, laut Sina einigermaßen identisch mit dem auf Forschungsreise in Los Angels weilenden Erzähler, Literatur und Philologie in eins und fabuliert eingedunkelt über das Problem des Schnees, der Sprache, über die Liebe und das Unsagbare. Wenn er dabei auch noch von Barthes bis Vonnegut zitiert, zeigt sich Sina fast überfordert. Doch in seiner konsequenten Negativität hat das Buch für ihn auch etwas Fesselndes.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH