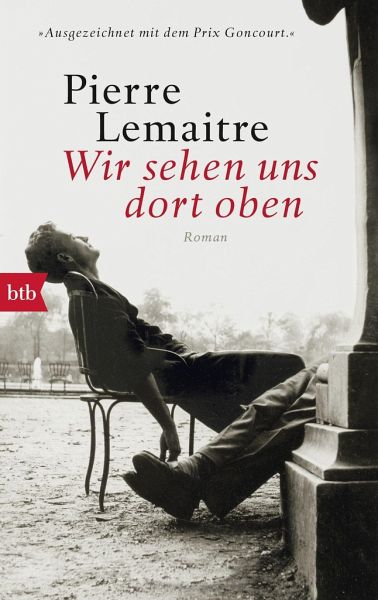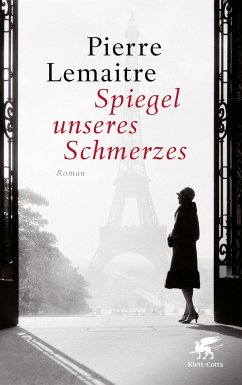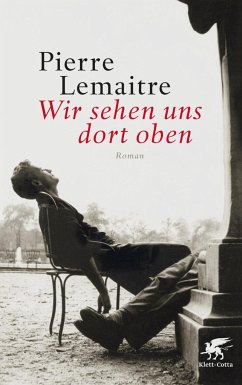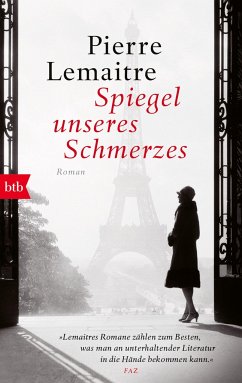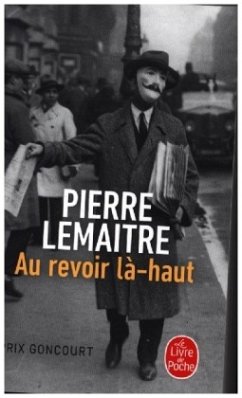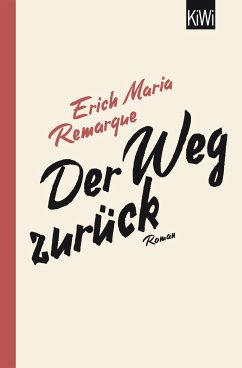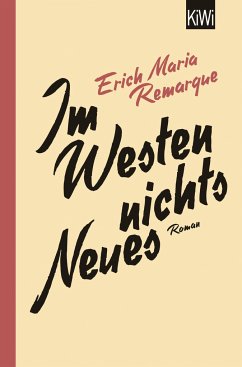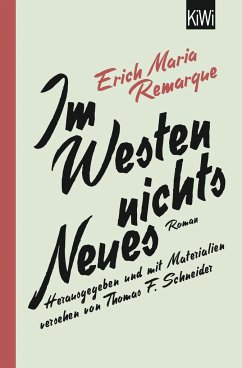Pierre Lemaitre
Broschiertes Buch
Wir sehen uns dort oben / Die Kinder der Katastrophe Bd.1
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





1919. Der Albtraum des Ersten Weltkriegs ist endlich vorbei, und das geschundene Frankreich versucht krampfhaft, in die Normalität zurückzufinden. Dabei sind die zahlreichen Soldaten, die nun von den Schlachtfeldern heimkehren, oft eher hinderlich. Das erfahren auch Albert und Édouard, der eine schwer traumatisiert, der andere entsetzlich entstellt. Also schmieden sie einen verwegenen Plan, um sich an den vaterländischen Heuchlern zu rächen. Niemand soll ungeschoren davonkommen. Vor allem nicht Offizier Pradelle, jener Mann, durch dessen Machtgier Albert fast ums Leben gekommen wäre und ...
1919. Der Albtraum des Ersten Weltkriegs ist endlich vorbei, und das geschundene Frankreich versucht krampfhaft, in die Normalität zurückzufinden. Dabei sind die zahlreichen Soldaten, die nun von den Schlachtfeldern heimkehren, oft eher hinderlich. Das erfahren auch Albert und Édouard, der eine schwer traumatisiert, der andere entsetzlich entstellt. Also schmieden sie einen verwegenen Plan, um sich an den vaterländischen Heuchlern zu rächen. Niemand soll ungeschoren davonkommen. Vor allem nicht Offizier Pradelle, jener Mann, durch dessen Machtgier Albert fast ums Leben gekommen wäre und der nun zu einem besonders zynischen Kriegsgewinner mutiert ist.
Pierre Lemaitre, 1951 in Paris geboren, ist Autor mehrerer preisgekrönter Kriminalromane. 'Wir sehen uns dort oben' wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem wichtigsten französischen Literaturpreis, dem Prix Goncourt. Der Autor lebt in Paris.
Produktdetails
- Verlag: btb
- Originaltitel: Au revoir là-haut
- Seitenzahl: 521
- Erscheinungstermin: 9. Mai 2017
- Deutsch
- Abmessung: 181mm x 117mm x 32mm
- Gewicht: 360g
- ISBN-13: 9783442748822
- ISBN-10: 3442748828
- Artikelnr.: 47030853
Herstellerkennzeichnung
btb Taschenbuch
Neumarkter Straße 28
81673 München
produktsicherheit@penguinrandomhouse.de
 buecher-magazin.deDie jungen Franzosen Édouard und Albert kämpfen gemeinsam an der Front kurz vor dem Ende des Ersten Weltkrieges. Der ehrgeizige, verlogene Leutnant Pradelle treibt die Truppe an, um sich nach dem Sieg gegen die Deutschen als Held feiern zu lassen. Édouard wird von Granatsplittern schwer verletzt, rettet aber seinen Freund Albert aus einem Trichter heraus. Verstümmelt wie er ist, will er nur unter falschen Namen in seine Heimatstadt Paris zurück, ohne seine wohlhabende Familie wiederzusehen. Lemaitre entlarvt die Vorstellungen der an der Front als "Helden" gefallenen Soldaten oder als "Sieger" in die Heimat Zurückkehrenden als Verschleierung sinnloser Gräuel. Nur einige skrupellose Akteure, die schon immer die Fäden in der Hand hielten, versäumen es auch in Friedenszeiten nicht, von der Misere der anderen zu profitieren. Fantasievoll und einfühlsam schildert der Autor die Freundschaft zwischen Albert und dem künstlerisch begabten Édouard. Gemeinsam gelingt es ihnen, in dem nach Kriegsende aufblühenden Geschäft mit Kriegsdenkmälern durch Bluff reich zu werden und der verlogenen Gesellschaft - in der sie nur Verlierer bleiben können - einen Spiegel vorzuhalten.
buecher-magazin.deDie jungen Franzosen Édouard und Albert kämpfen gemeinsam an der Front kurz vor dem Ende des Ersten Weltkrieges. Der ehrgeizige, verlogene Leutnant Pradelle treibt die Truppe an, um sich nach dem Sieg gegen die Deutschen als Held feiern zu lassen. Édouard wird von Granatsplittern schwer verletzt, rettet aber seinen Freund Albert aus einem Trichter heraus. Verstümmelt wie er ist, will er nur unter falschen Namen in seine Heimatstadt Paris zurück, ohne seine wohlhabende Familie wiederzusehen. Lemaitre entlarvt die Vorstellungen der an der Front als "Helden" gefallenen Soldaten oder als "Sieger" in die Heimat Zurückkehrenden als Verschleierung sinnloser Gräuel. Nur einige skrupellose Akteure, die schon immer die Fäden in der Hand hielten, versäumen es auch in Friedenszeiten nicht, von der Misere der anderen zu profitieren. Fantasievoll und einfühlsam schildert der Autor die Freundschaft zwischen Albert und dem künstlerisch begabten Édouard. Gemeinsam gelingt es ihnen, in dem nach Kriegsende aufblühenden Geschäft mit Kriegsdenkmälern durch Bluff reich zu werden und der verlogenen Gesellschaft - in der sie nur Verlierer bleiben können - einen Spiegel vorzuhalten.© BÜCHERmagazin, Nicole Trötzer
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Schon wieder ein Roman über den Ersten Weltkrieg, wollte Rezensentin Lena Bopp schon seufzen, musste aber bei der Lektüre von Pierre Lemaitres "Wir sehen uns dort oben" bald feststellen, dass dieser Roman seinesgleichen sucht. Denn zum einen beginne die Handlung in den letzten Tagen des Jahres 1918 und befasse sich zum anderen vor allem mit dem Geschehen nach dem Krieg, berichtet die Kritikerin. Fasziniert liest sie am Beispiel der beiden Soldaten Albert und Edouard, wie Zurückgekehrten versuchen, sich wiedereinzugliedern und wie schwer ihnen dieser Versuch von Staat und Gesellschaft gemacht wird. Vor allem aber würdigt die Kritikerin Lemaitres Gabe, dieses schwere und historisch brisante Thema äußerst unterhaltsam zu erzählen und seine beiden Protagonisten sympathisch und spannend bei ihren schließlich notgedrungen kriminellen Handlungen zu begleiten. Eine wunderbare Mischung aus Abenteuer- und Kriminalroman, lobt die Rezensentin, die sich schon jetzt auf die angekündigten Folgeromane freut.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Schon alles zum Ersten Weltkrieg gelesen? Aber wohl nichts, was so spannend wäre wie der Roman. ... Hundertfünfzig Jahre nach Balzac bespielt Lemaitre die menschliche Komödie als Satire.« Susanne Mayer, Die Zeit, 11.12.2014 Susanne Mayer Die Zeit 20141211
'Wir sehen uns dort oben' von Pierre Lemaitre ist ein Buch, das nachhallt. Schon während der Lektüre hat es mich stets zum Nachdenken angeregt und dieser Prozess endete auch nicht, als ich es aus der Hand legte. Das liegt zum einem an dem Thema, denke ich. Der erste Weltkrieg ist ein …
Mehr
'Wir sehen uns dort oben' von Pierre Lemaitre ist ein Buch, das nachhallt. Schon während der Lektüre hat es mich stets zum Nachdenken angeregt und dieser Prozess endete auch nicht, als ich es aus der Hand legte. Das liegt zum einem an dem Thema, denke ich. Der erste Weltkrieg ist ein Thema, das mich stets berührt. Krieg allgemein. Das Leben, das die Protagonisten führen weicht einfach so krass von meinem ab, dass man gar nicht anders kann, als sich selbst die Lächerlichkeit der eigenen Probleme vor Augen zu führen. Nach solch einem Kontakt mit der (fiktiven) Vergangenheit bin ich meist unglaublich dankbar für mein eigenes Leben. So auch diesmal, da der Autor ein glaubhaftes Gefühl für die damalige Zeit vermittelt.
In diesem Buch geht es überwiegend um die zwei Soldaten Albert und Édouard, die für Frankreich im ersten Weltkrieg gekämpft haben und die durch mehrere (unglückliche) Fügungen des Schicksaals sowas wie Freunde werden. Der Begriff 'Freunde' ist irgendwie passend und unpassend zugleich - das Verhältnis der beiden ist durchaus speziell. So wie alles irgendwie speziell an den Charakteren dieses Buches ist, worin für mich auch der besondere Reiz lag. Die Handlung folgt einem eher gemächlichen Spannungsbogen, dennoch war mir nie langweilig. Das lag an der Art, wie die Charaktere beschrieben wurden. Selten habe ich Büche gelesen, in denen der Unterschied zwischen der Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung der Personen so deutlich wurde. Dies gelang durch die Perspektivwechsel, die zwar mitten im Kapitel stattfanden, aber durch einen Absatz gut gekennzeichnet waren. So wurde einem erst erklärt, wie Person A ins Gespräch ging, häufig völlig überzeugt, der anderen Person überlegen zu sein. Man fühlte sich sicher, sah den Ausgang des Gesprächs schon vor sich. Doch dann erwischte es einen ebenso kalt wie Person A, als Person B offenbarte, wie sie dachte. Dabei kamen die Personen keinesweges alles gut weg, häufig meine ich Kritik gegen bestimmte Denkweisen herausgelesen zu haben. Während man in manchen Büchern von nahezu perfekten "Menschen" umgeben ist, musste man hier manchmal mühsam suchen, positive Züge an den Charakteren zu entdecken. Als Beispiel sei hier Merlin genannt, der mich unglaublich fasziniert hat, da meine Emotionen beim Lesen zwischen Fassungslosigkeit, Ekel und Bewunderung schwankten. Da war wirklich alles vertreten.
Das Ende ist für mich genau die richtige Mischung aus traurigem und glücklichem Anteil. Es wirkt realistisch.
Fazit: Zu Recht Gewinner des großen französichen Literaturpreises Prix Goncourt. Unglaublich vielschichtige Charaktere, von denen das Buch lebt.
Mehr Bewertungen auf www.buchkatzen.weebly.com
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Wir schreiben das Jahr 1917 und befinden uns auf einem Schlachtfeld in Frankreich. In den Schützengräben geht das Gerücht um, dass der Krieg bald zu Ende ist. Klar wollen die Soldaten die es bis hier her geschafft haben nicht mehr ihr Leben riskieren. Doch Leutnant Pradelle sieht das …
Mehr
Wir schreiben das Jahr 1917 und befinden uns auf einem Schlachtfeld in Frankreich. In den Schützengräben geht das Gerücht um, dass der Krieg bald zu Ende ist. Klar wollen die Soldaten die es bis hier her geschafft haben nicht mehr ihr Leben riskieren. Doch Leutnant Pradelle sieht das ganz anders. Er will sich noch einmal hervortun und zettelt eine Intrige an. Als der immer melancholisch aussehende Albert dem Leutnant auf die Schliche kommt, kostet ihn das fast das Leben. Dass er überlebt, hat er nur dem jungen Édouard zu verdanken, der ihm in letzter Sekunde das Leben rettet. Aber zu welchem Preis? Aus Dankbarkeit verschafft Albert ihm eine neue Identität und die Beiden bleiben nach dem Krieg zusammen. Immer wieder kreuzen sie den Weg von Leutnant Pradelle und alle treiben sie unlautere Geschäfte....
Ich stehe wieder vor der sehr schwierigen Aufgabe, dieses Buch zu bewerten. Aber wie soll man ein Buch bewerten das vom Krieg erzählt, von der schweren Zeit danach, von den Verletzten oder nicht mehr lebensfähigen Menschen? Von den kaputten Seelen und dem ewigen Kampf ums Überleben? Es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, aber ich werde mein Bestes geben.
Der erste Teil des Buches handelt vom letzten Ansturm der Franzosen auf eine deutsche Stellung. Viele der Soldaten werden getötet oder verwundet, aber die Deutschen sind geschlagen. Viele Mütter werden um ihre Söhne weinen. Der Autor hat es wunderbar verstanden die Gefühle und die Ängste der Soldaten an den Leser zu transportieren. Ich litt sehr mit ihnen. Als Albert dann beinahe gestorben wäre, hoffte und bangte ich und war überglücklich, dass Édouard so aufmerksam war und sich trotz seiner schweren Verletzung daran machte seinen Kameraden zu retten. Was Édouard durchleiden muss ist schlimmer als die Hölle und am liebsten hätte ich die Seiten einfach übersprungen. Aber ich habe mich zusammengerissen und wirklich Wort für Wort gelesen.
Auch die Nachkriegszeit hat Pierre Lemaitre sehr gut eingefangen und durch seine Sprache und seinen Schreibstil war ich überall mit dabei. Was mir ziemlich verwirrte war, dass Ruhm und Ehre das Größte waren, das höchste Gut jedes Soldaten. Jeder sprach davon, jeder wollte die Ehre und den Ruhm für sich beanspruchen. Aber trotzdem waren so viele Menschen in unmoralische oder verbotene Geschichten verwickelt. Da wurde das große Geld gemacht, in dem man gefallene Soldaten umbetten ließ und dort wurde mit Kriegsdevotionalien gehandelt. Jeder musste sehen wo er bleibt und wie er für sich das Meiste und Beste herausholt.
Trotz allem hat mich die Geschichte gefangen, betroffen gemacht und mich hoffen lassen, niemals so eine schreckliche Zeit miterleben zu müssen. Ich habe gebangt, gehofft, gelitten und gehasst aber manchmal auch gelächelt. Lemaitre hat hier wirklich eine außergewöhnliche Geschichte erschaffen, die trotz ihrer Schrecken und ihrer Gemeinheiten richtig Spaß gemacht hat. Die kleinen Gaunereien, der Zusammenhalt, die Freundschaft, all das machte das Buch so lesenswert für mich.
Ich vergebe für "Wir sehen uns dort oben" 5 von 5 Punkte und bin dankbar, dass ich mich an dieses Buch heran getraut habe. Es ist wirklich gut ab und zu mal über den Tellerrand zu schauen und Bücher zu lesen, die eigentlich nicht dem Beuteschema entsprechen. Für mich war das jedes mal eine große Bereicherung. Vielen Dank Monsieur Lemaitre, für dieses Buch. Es ist keine Geschichte, die man mal eben so nebenbei liest, denn sie hat es verdient, dass man sich ihr voll und ganz widmet.
© Beate Senft
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Makabre Schwejkiade
Mit dem 2013 erschienenen historischen Roman «Wir sehen uns dort oben» hat der bis dato nur für seine Krimis bekannte französische Schriftsteller Pierre Lemaitre erstmals dieses Genre verlassen und den Ersten Weltkrieg und dessen unmittelbare Folgen …
Mehr
Makabre Schwejkiade
Mit dem 2013 erschienenen historischen Roman «Wir sehen uns dort oben» hat der bis dato nur für seine Krimis bekannte französische Schriftsteller Pierre Lemaitre erstmals dieses Genre verlassen und den Ersten Weltkrieg und dessen unmittelbare Folgen thematisiert. Dieser erste «literarische» Roman aus seiner Feder ist gleichwohl mit typischen Krimi-Elementen angereichert, die für Spannung sorgen sollen in seiner gesellschaftskritischen Geschichte. Strammer Patriotismus und verlogenes Heldengedenken werden hier mit satirischen Mitteln als reine Farce entlarvt. Der in Frankreich überaus erfolgreiche Roman wurde mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet, in viele Sprachen übersetzt, vier Jahre später ebenso erfolgreich verfilmt und gleich mehrfach mit dem César-Filmpreis prämiert.
In einem absolut sinnlos gewordenen Stellungskrieg mehren sich Anfang November 1918 die Gerüchte, ein Waffenstillstand stehe unmittelbar bevor. Der skrupellose Leutnant Pradelle will sich vorher unbedingt noch durch eine Heldentat hervortun, um Hauptmann zu werden und damit dann auch seinen sozialen Aufstieg nach dem Krieg zu befördern. Er befiehlt deshalb einen riskanten Vorstoß in seinem Frontabschnitt an der Maas, der mit hohen Verlusten endet. Albert wird in einem Granattrichter verschüttet, Édouard wird am Kopf schwer verletzt, es gelingt ihm aber, den verschütteten Kameraden vor dem Ersticken zu retten. Beide werden enge Freunde, Albert kümmert sich rührend um den im Gesicht grauenhaft entstellten Édouard, der ihm im schlimmsten Kriegsgetümmel so selbstlos das Leben gerettet hat. In der Nachkriegszeit steigt Pradelle mit hanebüchenen Methoden ins lukrative Geschäft mit dem Umbetten von nur provisorisch in Frontnähe bestatteten Kriegsopfern ein, deren Angehörige sie zurückholen und in der Heimat würdig beerdigen wollen. Der künstlerisch begabte Édouard entwickelt die kühne Idee, mit einer Scheinfirma ganz groß ins Geschäft mit Kriegsdenkmälern einzusteigen, die er allerdings niemals zu bauen gedenkt. In einer Hauruck-Aktion, mit hohen Rabatten bis zu einem bestimmten Stichtag, wollen die Freunde nämlich alle bis dato eingegangenen Anzahlungen kassieren und dann unter falschem Namen ins Ausland fliehen. Tatsächlich kassieren die ins Kriminelle abgerutschten Freunde auf diese Art mehr als eine Million Franc von vielen arglosen, unbedarften Kunden, bevor sie abtauchen, während Pradelle mit seinen skrupellosen Geschäftsmethoden auffliegt, sein ganzes Vermögen verliert und im Gefängnis landet.
Mit seinem Roman decouvriert Pierre Lemaitre die patriotische Heldenverehrung für die gefallenen französischen Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg als verlogene Ablenkung von den tatsächlichen Gräueln des unsäglichen Gemetzels auf den Schlachtfeldern mit seinen Millionen von Toten. Unter der wirtschaftlichen Misere als Folge des Krieges leiden aber vor allem die vielen Kriegsversehrten, die sich nur schwer wieder eingliedern können in die Zivilgesellschaft, während die Wohlhabenden sowie gerissene Profiteure gute Geschäfte machen auch in diesen schweren Zeiten.
In zwei Handlungssträngen werden abwechselnd die Geschichten der beiden vom Krieg gezeichneten Landser sowie die ihres brutalen Offiziers erzählt, sie sind lose miteinander verflochten und laufen ganz am Schluss erst zusammen. Über weite Strecken ist diese stilistisch anspruchslose Erzählung ziemlich langweilig zu lesen, sie steigert sich erst zum leider vorhersehbaren Finale hin. Ein Showdown allerdings, der, sogar noch im ergänzenden Epilog, an Kitsch kaum zu überbieten ist. Die Figuren sind maßlos übertrieben gezeichnet, es gibt kein Klischee, das da nicht bedient wird, trotzdem erzeugen sie alle kaum Empathie, ihr Inneres bleibt verborgen. Der krimiartig mit vielen Abschweifungen konstruierte Plot weist zudem auch etliche Ungereimtheiten auf, er ist als sarkastisches Sittenbild bestenfalls eine, vergleichsweise allerdings deutlich weniger amüsante, französische Schwejkiade.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote