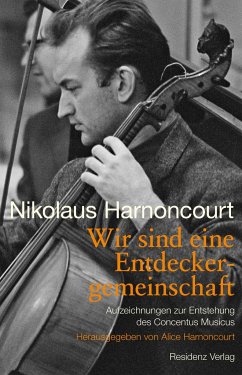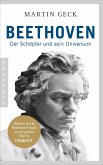Nikolaus Harnoncourt begann sich schon sehr früh mit der Alten Musik, ihrer Spielweise und dem Klang alter Instrumente zu beschäftigen. 1953 gründete er mit seiner Frau Alice und weiteren Musikern den berühmten Concentus Musicus, um seiner Arbeit mit Originalinstrumenten und der musikalischen Aufführungspraxis von Renaissance- und Barockmusik ein Forum zu geben. Erst nach vier Jahren wagte der Concentus Musicus den Schritt an die Öffentlichkeit. Alice Harnoncourt hat die unveröffentlichten Tagebucheinträge und Notizen ihres Mannes gesammelt, die von seinen Recherchen auf den Spuren der Originalklänge erzählen. Es ist eine spannende und unterhaltsame Reise, in der Harnoncourt viel vollbringen musste, um sich an den Originalklang heranzuhören.

Die Erinnerungen des Dirigenten Nikolaus Harnoncourt erzählen nicht nur etwas über alte Musik. Sie rechnen auch ungeschönt und vergnüglich mit Machtmissbrauch und Verlogenheit des Betriebs ab.
Am 5. März vor zwei Jahren starb der Dirigent, Cellist, Sprachbildner und Meisterschnitzer Nikolaus Harnoncourt. Er fehlt an allen Ecken und Enden, weil er anregen konnte, ohne recht haben zu wollen, weil er provozierte, aber Widerspruch ertrug, weil er Phantasie hatte, die durch Partituren gedeckt war, und weil er immer nach Argumenten suchte, die nichts mit seiner Person zu tun hatten. Ein spätes Geschenk an die Nachwelt sind nun seine Erinnerungen über die Entstehung des Concentus Musicus Wien, des von ihm begründeten Spezialensembles für Alte Musik auf historischen Instrumenten, die seine Witwe Alice aus dem Nachlass herausgebracht hat.
Gedacht waren sie für die eigenen Kinder und Enkel; Alice Harnoncourt aber, die mehr als ein halbes Jahrhundert lang im Ensemble als Geigerin, sogar als Konzertmeisterin mitspielte, entschied zu Recht, dass sie öffentliches Interesse beanspruchen dürfen.
Es ist ein Buch über ideologische Kämpfe des Musizierens, über die Hochnäsigkeit der akademischen Musikwissenschaft gegenüber den vitalen Musikbegriffen philologisch wie spielpraktisch interessierter Interpreten während der sechziger und siebziger Jahre, ein Buch über listenreiche Jagden nach alten Instrumenten, vor allem aber über die Freude lebenslangen Lernens, das permanente Sich-Zubewegen auf neue Gedanken. Der Klang der Sprache von Harnoncourt, der als Kind des alten Adels in einer Welt des Handwerks und der Landwirtschaft groß wurde, ist wie der seines Musizierens: eigentümlich, markant, voll kräftiger Aromen.
Nimmt man nur den ersten Absatz, möchte man dieses Buch - konsequent in alter Rechtschreibung - für Literatur halten: "Warum muß ich so oft der ,Anführer' sein? Dauernd etwas erfinden und entwerfen, um es in den Sommerferien am Brandhof zu machen? Perpetuum mobile mit Wasser und mit Hebeln - das war mir dann zu kompliziert, ich hab schon geahnt, daß das nicht gehen kann wegen dem Luftwiderstand und wegen der Reibung. Dann hab ich lieber Schmetterlinge in großen Gläsern gezüchtet. Aber wirklich gereizt hat mich das Unmögliche, weil ich immer geglaubt habe, daß es doch möglich ist. Ich habe immer Parteien gegründet, so lange, bis ich gezwungen wurde, dabeizusein, und da ging es dann ums Entkommen. ,Gefolgsmann' konnte ich nicht sein. Es gab keine Regeln, die ich anerkennen wollte. Sind so alle Menschen - oder alle Kinder? Dann wurde ich vielleicht zum permanenten Kind."
Der Concentus Musicus Wien, der offiziell 1953 gegründet wurde, hatte sich inoffiziell schon einige Jahre zuvor gefunden: aus lauter Neugier für ältere Musik - von Johann Sebastian Bach und aus der Zeit davor - für alte Instrumente. Durch das Spielen reifte eine Erkenntnis, die eingreifen sollte in die Interpretationsgeschichte: "Man neigt heute zu der Ansicht, jede Modernisierung sei zugleich eine Verbesserung - bei den Musikinstrumenten trifft das absolut nicht zu. Es zeigt sich vielmehr in zahllosen praktischen Versuchen, daß jede Zeit die für die Wiedergabe ihrer Musik optimalen Möglichkeiten besaß."
Im Nachgang der eigenen Bildungsgeschichte, einschließlich aller Widerstände, wird auch die Welt im Nachkriegs-Österreich lebendig, als es überall von "alten Nazis" wimmelte: an den Universitäten, in den Museen und Orchestern. Die Beschreibungen von Harnoncourts Alltag als Cellist der Wiener Symphoniker strotzen vor Antisemitismus und Alkoholismus.
Seinen anekdotischen Exkurs über Herbert von Karajan als Chefdirigent muss man gelesen haben. Ein Mann erscheint da, der alles, Auftreten, Kleidung, Haartracht, auf seine Außenwirkung hin inszenierte, inklusive seine Patzer als Dirigent, wofür er durch gezielte Blicke dem Publikum die Schuld zu geben verstand. Der Tänzer Harald Kreutzberg soll Karajan Privatstunden gegeben haben, um die Wirksamkeit von Dirigiergesten einzustudieren. Auf Tourneen des Orchesters fuhr Karajan vor dem Bus mit seinem Sportwagen vorweg. "Einer durfte mitfahren, der saß dann abends bleich und grün im Orchester", schreibt Harnoncourt. Die Musiker lachten, bis Karajan zum lautesten Lacher sagte: "Sie fahren morgen mit mir". In steten Wechselbädern von Zutraulichkeit und Demütigung hielt Karajan die Musiker in Angst.
Auch der Komponist Paul Hindemith, unter dessen Leitung der junge Harnoncourt im "Orfeo" von Claudio Monteverdi spielte, wird als Ausbund an philologischer Inkompetenz vorgeführt, als Schwindler und menschliches Ekel. Rücksichten nimmt Harnoncourt in diesen Erinnerungen, was für ihren privaten Charakter spricht, kaum. Über eine Begegnung mit der jungen Sängerin Jessye Norman heißt es geradezu boshaft: "das später kapriziöse Riesenschlachtroß war damals ein schlankes, bescheidenes Mädchen, das wunderschön Purcell sang".
Eine Aufführung von Bachs Matthäuspassion unter der Leitung von Karl Richter, den Harnoncourt hier als denkfaulen Scharlatan zu demaskieren sucht, erinnert ihn an ein Wunschkonzert im Volksempfänger anno 1943: "Sonntagssendung ,Für Front und Heimat' des Reichssenders Großdeutschland, Wilhelm Strienz singt ,Glocken der Heimat', dazu die Orgel mit einem ,Muttertags-Sound'".
Hier wird temperamentvoll zu Vergeltungsschlägen ausgeholt. Harnoncourt behauptete immer, er hätte nie Diplomat werden können, weil man dazu von Berufs wegen lügen müsse. Sein Ingrimm gegen die Musikwissenschaft und die jahrelange Zurücksetzung, die er durch sie erfuhr, entlädt sich in einer Parodie auf einen akademischen Aufsatz "Aus der Vierteljahresschrift der Gesellschaft radikaler Musikwissenschaftler". Darin zitiert Harnoncourt die Göttinger Dissertation von Heinz-Gutbrand Müller Kleinwanzleben aus dem Jahr 1960: "Bachs Mahlzähne und ihre Abnützung während seiner Köthener Zeit - eine musico-psycho-pathologische Studie über die Zusammenhänge des Kauvorganges mit seelischen Allgemeinzuständen beim Künstler, unter besonderer Berücksichtigung des musikschöpferischen Menschen Mitteldeutschlands im 18. Jh.".
Heute, da sich die frühere Geringschätzung Harnoncourts auf Seiten der Akademiker in höchste Bewunderung verwandelt hat, liest man eine solche Suada mit ununterdrückbarem Vergnügen. Es tauchen Menschennamen auf in diesem lebensvollen, wissenssatten Buch, die klingen, als hätte Fritz von Herzmanovsky-Orlando sie sich für einen Roman ausgedacht. Aber für alle - mit Ausnahme von Heinz-Gutbrand Müller Kleinwanzleben - gilt wohl, was für die letzte beschriebene Person in diesem Buch, den Bratscher Karl Trötzmüller, gilt: "Diesen liebenswerten Menschen gab es wirklich". So lautet, als Zeichen eigener Dankbarkeit, der letzte Satz.
JAN BRACHMANN
Nikolaus Harnoncourt: "Wir sind eine Entdeckergemeinschaft". Aufzeichnungen zur Entstehung des Concentus Musicus.
Hrsg. von Alice Harnoncourt. Residenz Verlag, Salzburg und Wien 2017. 208 S., geb., 24.- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main