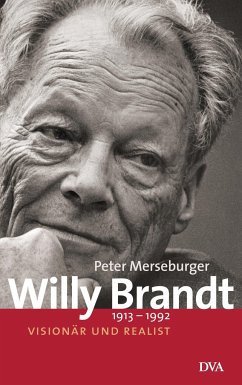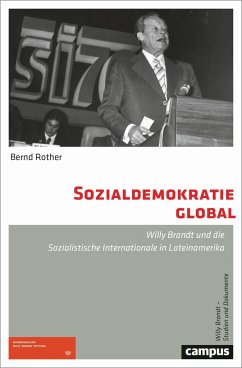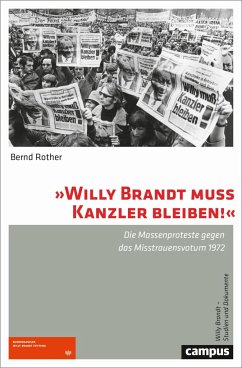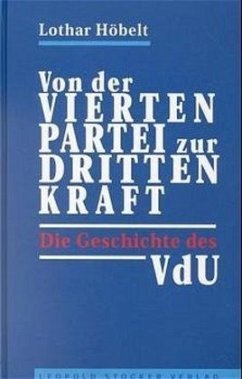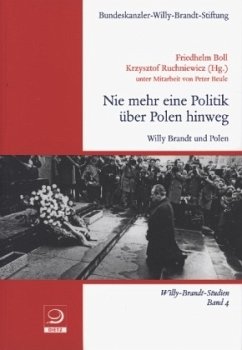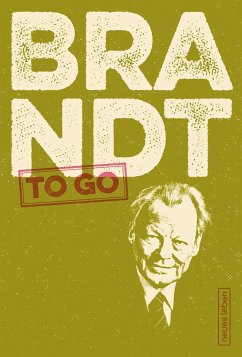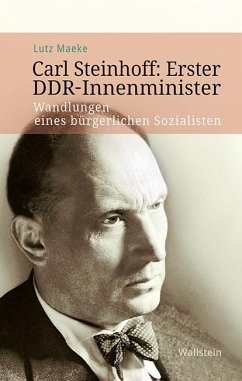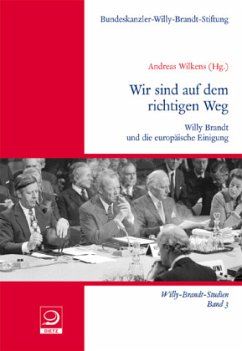»Wir wollen mehr Demokratie wagen«
Antriebskräfte, Realität und Mythos eines Versprechens
Herausgegeben: Schildt, Axel; Schmidt, Wolfgang
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
32,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"Wir wollen mehr Demokratie wagen." Dieser Satz von Willy Brandt ist zum legendären Leitspruch für die Reformen in der Bundesrepublik am Übergang von den 1960er- zu den 1970er-Jahren geworden. Der Sammelband analysiert die Hintergründe und die gewollten sowie die ungewollten Folgen und Wirkungen jenes Versprechens und ordnet die Demokratisierungs- und Liberalisierungsbestrebungen der Ära Brandt in den internationalen Kontext ein.Willy Brandt weckte 1969 hohe Erwartungen, die von der sozial-liberalen Koalition aber nur zum Teil erfüllt wurden. Zunächst beschleunigten sich gesellschaftlic...
"Wir wollen mehr Demokratie wagen." Dieser Satz von Willy Brandt ist zum legendären Leitspruch für die Reformen in der Bundesrepublik am Übergang von den 1960er- zu den 1970er-Jahren geworden. Der Sammelband analysiert die Hintergründe und die gewollten sowie die ungewollten Folgen und Wirkungen jenes Versprechens und ordnet die Demokratisierungs- und Liberalisierungsbestrebungen der Ära Brandt in den internationalen Kontext ein.Willy Brandt weckte 1969 hohe Erwartungen, die von der sozial-liberalen Koalition aber nur zum Teil erfüllt wurden. Zunächst beschleunigten sich gesellschaftliche Demokratisierungsprozesse von unten, deren Akteure die Forderung nach "mehr Demokratie" häufig viel radikaler auslegten, als es den Regierungsparteien lieb war. Was Umfang und Tempo der Reformen anging, lag die Bundesrepublik im internationalen Vergleich gleichwohl mit an der Spitze. In der bundesdeutschen Außenpolitik der 1970er- und 1980er-Jahre spielte das Konzept der Demokratie dagegen eine überraschend geringe Rolle.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.