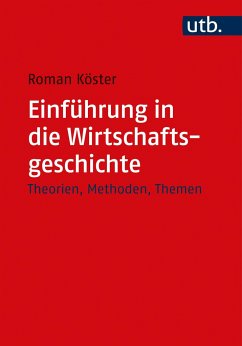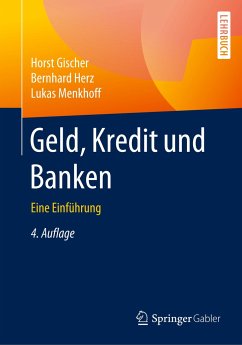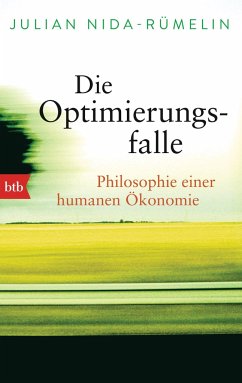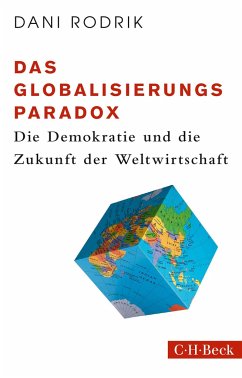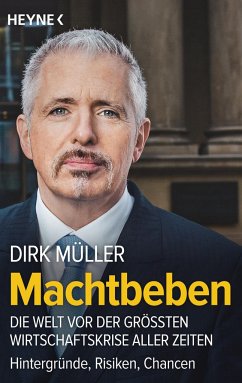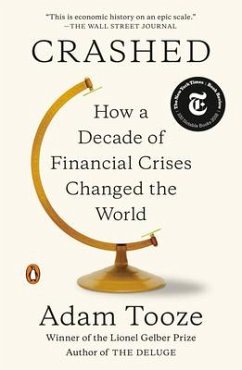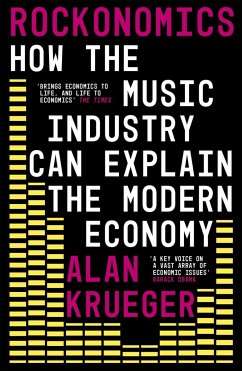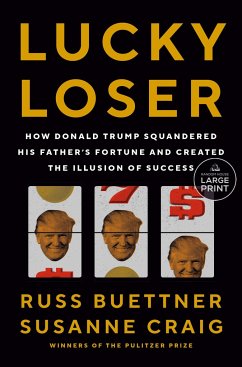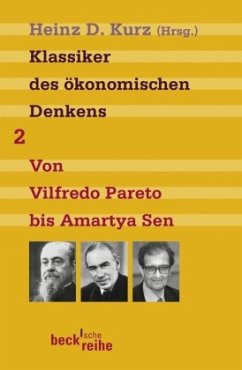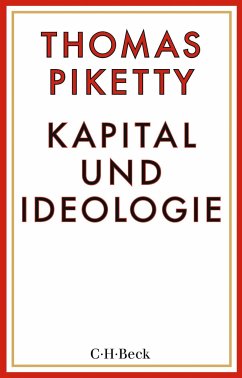Nicht lieferbar
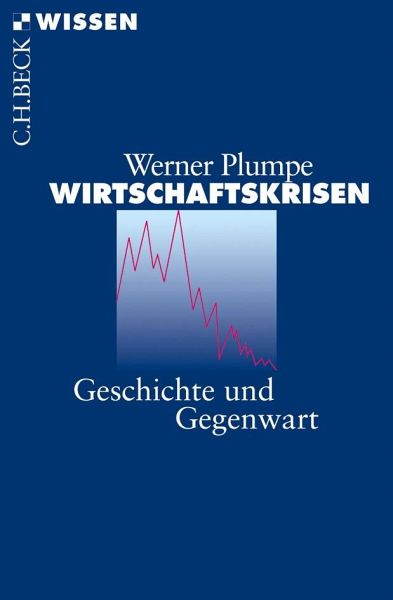
Wirtschaftskrisen
Geschichte und Gegenwart
Mitarbeit: Dubisch, Eva J.
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Das Buch gibt einen knappen Überblick über Arten, Ursachen und Verläufe der Wirtschaftskrisen von der Frühmoderne bis zur Gegenwart und macht die heutigen Probleme dadurch erst richtig verständlich. Es zeigt sich, dass die immer wieder gezogenen Parallelen zur Weltwirtschaftskrise von 1929 mit ihren apokalyptischen Folgen ins Leere laufen. Die Krisen des letzten Jahrzehnts sind vielmehr durch Bedingungen geprägt, wie sie sich in der vergleichsweise liberalen Weltwirtschaft vor 1914 beobachten lassen.