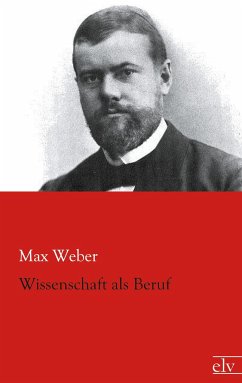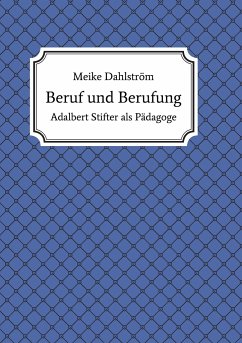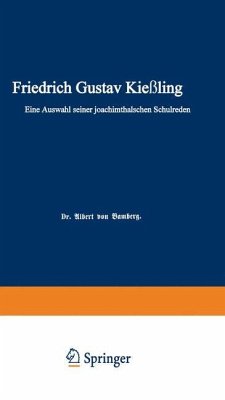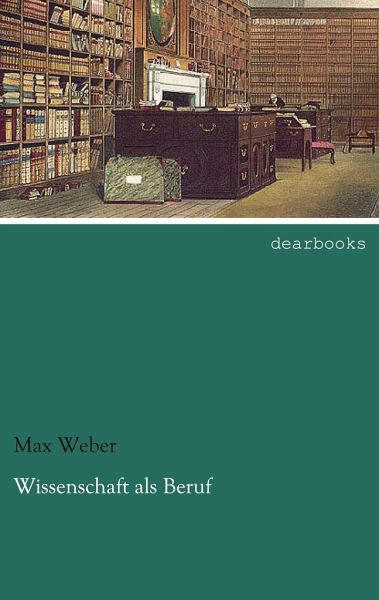
Wissenschaft als Beruf
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
11,90 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Max Webers Text geht zurück auf einen 1917 in München vor Studienanfängern gehaltenen Vortrag über die Beruf des Wissenschaftlers. Dabei weist er zunächst auf die - auch heute noch - überaus unsicheren, weil von unkalkulierbaren Zufällen abhängigen Berufsaussichten hin, um sich dann der Spezialisierung als unabdingbarer Voraussetzungen für die wissenschaftliche Arbeit zuzuwenden. Nicht zuletzt unterscheidet Weber dabei streng zwischen den exakten Naturwissenschaften und den auf Sinnfragen ausgerichteten Geisteswissenschaften, deren fortschreitende Politisierung er als schädlich ableh...
Max Webers Text geht zurück auf einen 1917 in München vor Studienanfängern gehaltenen Vortrag über die Beruf des Wissenschaftlers. Dabei weist er zunächst auf die - auch heute noch - überaus unsicheren, weil von unkalkulierbaren Zufällen abhängigen Berufsaussichten hin, um sich dann der Spezialisierung als unabdingbarer Voraussetzungen für die wissenschaftliche Arbeit zuzuwenden. Nicht zuletzt unterscheidet Weber dabei streng zwischen den exakten Naturwissenschaften und den auf Sinnfragen ausgerichteten Geisteswissenschaften, deren fortschreitende Politisierung er als schädlich ablehnt.