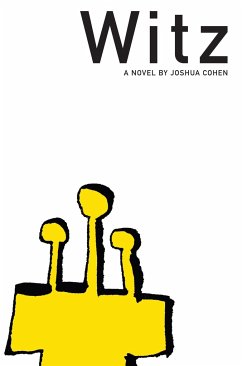On Christmas Eve 1999, all the Jews in the world die in a strange, millennial plague, with the exception of the firstborn males, who are soon adopted by a cabal of powerful people in the American government. By the following Passover, however, only one is still alive: Benjamin Israelien; a kindly, innocent, ignorant man-child. As he finds himself transformed into an international superstar, Jewishness becomes all the rage: matzo-ball soup is in every bowl, sidelocks are hip; and the only truly Jewish Jew left is increasingly stigmatized for not being religious. Since his very existence exposes the illegitimacy of the newly converted, Israelien becomes the object of a worldwide hunt...
Meanwhile, in the not-too-distant future of our own, "real" world, another last Jew-the last living Holocaust survivor-sits alone in a snowbound Manhattan, providing a final melancholy witness to his experiences in the form of the punch lines to half-remembered jokes.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Meanwhile, in the not-too-distant future of our own, "real" world, another last Jew-the last living Holocaust survivor-sits alone in a snowbound Manhattan, providing a final melancholy witness to his experiences in the form of the punch lines to half-remembered jokes.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
"The sort of postmodern epic that arrives like a comet about once every decade, like Infinite Jest or Gravity's Rainbow. Like any epic, it defies summary and overflows with puns, allusions, digressions, authorial sleights of hand and structural gags-in the tradition of Thomas Pynchon, James Joyce, Jonathan Swift and Laurence Sterne." New York Observer

Eine radikale Erzählung des jüdischen Schicksals: Joshua Cohens Monumentalroman "Witz"
In diesem Buch geht es um die schillernde Bedeutung seines Titels: um "-witz" als Suffix und um "Witz" im amerikanischen Sinn von "joke" (jemanden hereinlegen). Beides hat, so wie der Text, Megadimension. Und wie im Roman "Ulysses" von James Joyce, den Cohen technisch und stilistisch auf die Spitze treibt, steht auch sein Titel für ein Programm. Ulysses: Heimkehr als Reise durch das Rauschen der Zeit. Witz: das Ende als Schlag ins Kontor. Die punchline ist vernichtend, also eine Vernichtung. Witz ist die Waffe der Unterlegenen. "Witz" und "Ulysses" sind Konzepte, mentale Gerüste; in sie passen die Autoren die Wege ihrer Helden durch die Alltäglichkeiten ihrer Epochen ein.
Wichtige Schlüssel zu seinem Werk hat der Sprachkünstler Joshua Cohen in seiner gewaltigen Essaysammlung "Attention" (2018) deponiert. "Jeder weiß, was Aufmerksamkeit ist", zitiert Cohen da eingangs den Psychologen William James und untersucht sogleich ihr Gegenteil, die Abgelenktheit (distraction). Von ihrer Schwester, der Abschweifung (digression), behauptete der Essayist Montaigne, sie gehöre zum Schreiben, denn die Wahrnehmung der Welt (und nicht die "Wahrheit") sei das Sujet der Literatur. Cohen könnte Montaigne mit dem Talmud antworten: "Wenn einer des Weges geht, liest, sich unterbricht und sagt: 'Wie schön ist dieser Baum!', von ihm sagt die Schrift, er sei gegen sich selbst schuldig geworden." Für Cohen ist die ständige Ablenkung durch Triviales ein Grundübel unseres Seins.
Dagegen hat er sein Sprachkunstwerk geschaffen. Klar, wenn einer einen Witz erzählt, spitzt jeder die Ohren, denn man will die Pointe mitbekommen. Witz macht spitz. In "Witz" geht es darum, neunhundert Seiten lang gespitzt zu lesen. Dann schält sich unter der Masse der Wortwitze, Anspielungen und Kulturkürzel eine Handlung heraus. "Kavanah" heißt diese Form der absoluten Konzentration auf einen Text und die Entfaltung seiner Bedeutungen in der jüdischen Kultur, und erreicht wird durch sie "devekut" (eine Verbindung mit der Essenz). Cohens "Witz" steht als Sprachkunstwerk gegen Verflachung und Linearität. Wenn man sich darauf einlässt, ohne darüber nachzudenken, ob "Witz" gut ist oder schlecht, erlebt man einen Sprachrausch, wie er in dieser Intensität vielleicht nur in "Finnegans Wake" erfahrbar ist. Was Cohen vom Schreiben will, so sagt er in "Attention", sei total immersion (totales Abtauchen). Für ihn gehören dazu auch Szenen von grotesker Vulgarität.
Dass dieser Sprachrausch auch beim Lesen der Übersetzung erfahrbar ist, verdanken wir der Meisterschaft von Ulrich Blumenbach, der einen dichten, lexikalisch reichen Text gewebt hat ("Hutzelfuß", "Stirn mit Frakturfalten") und noch für die absurdesten puns deutsche Versionen fand. Ein Mann provoziert seine Frau, indem er "hors d'oeuvre" wie "whore's divorce" ausspricht; bei Blumenbach: "hurt döfer". Es gibt zwar hie und da Aussetzer. Ein Besteck aus "vermeil" ist nicht "scharlachrot", sondern aus Silber mit Goldüberzug. Wenn ein Jude vor dem Nachtmahl am Freitag zu Ehren des Sabbats eine Hühnersuppe auf dem Herd entdeckt und ruft: "tell me I am that lucky", würde er auf Deutsch nicht sagen: "Sag mal, sollte ich wirklich so ein Schwein haben." Wenn nach dem Nachtmahl "in their chairs still, they bench", dann "drücken" Juden nicht "die Bank", sondern sprechen den Segen (benschen, vom lateinischen benedicere). All dies verblasst jedoch vor Blumenbachs Leistung, ein deutsches Äquivalent geschaffen zu haben, das sich wie ein literarisches Werk liest und oft klarer ist als das Original.
Die göttlichen Versprechen sind hier Attrappen.
Der Roman beginnt in einer Synagoge ("wüst und leer") acht Tage vor Weihnachten. Zum Abendgottesdienst vor Schabbatbeginn füllt sie sich: "Sie sind paarweise aufgestellt, zwei von jeder Art . . . Sie sind ausgeruht, ausgewaschen, ausgekleidet; sie sind zum Duschen angetreten und zum Scheren." So geht das Bild der vollgepackten Arche Noahs in das der Gaskammern über. Den Gottesdienst persifliert Cohen als Opernabend, womit er andeutet, wie willig die europäischen Juden den Vorhang der "Hochkultur" vor die Zeichen des kommenden Sturms zogen. Die einfallende Nacht ist historisch doppelt aufgeladen: "Von den verbliebenen Farben wurde die Hälfte zu Mond und Sternen gebleicht, bis zur Weiße entlaust . . . Während unser Rabbi, ein Erstgeborener . . ., über die Holzdielen vor der Kanzel büttelt, bereitet sich die zehnte Plage vor, wartet betriebsbereit in den Kulissen." Die neunte Plage bereitet der zehnten den Weg, das Bogengewölbe (arch) den Auftritt (entrance).
Damit ist das ulyssisch-odysseische Reisemotiv ausgesprochen. In diesem Roman geht es um den Exodus ins Gelobte Land, der ein Exitus ist. Denn die Reise führt zu jenem Torbogen, auf den die Gleise zulaufen. Damit ist das erste -witz genannt (Auschwitz) und der erste Witz aufgelöst. Die Duschattrappen sind practical jokes. Für die Gäste im nachfolgenden Nachtmahl bei Hanna Israelien, eine der dichtesten Szenen des Romans, ist der Herd/Ofen (mit seiner Suppe) zentral. Zu ihm zieht es die Gäste, zum "Ofen am Ende des Torbogens, dem Tor zum Ofen und auf der anderen Seite wieder hinaus".
Die Gäste schnuppern, "diese Nudeln steigen ihnen entgegen . . . Räucherungen wie zu Tempeltagen, aber sie selbst sind die Opfer, und doch sind diese Gaben noch für sie gedacht, was ein Martyrium bedeutet". Die göttlichen Versprechen sind Attrappen. Auserwählung bestimmt die Opfer zur Himmelfahrt durch die Öfen. Das Bütteln der Rabbiner ist umsonst, ist Theater, eine Vorstellung für den Einen. Das ist die radikale These des Romans.
In der Nacht wird Benjamin geboren, Hannas erster Sohn (ben) nach zwölf Töchtern. Er ist als -witz (Sohn von) der Titelheld des Romans. Mit Bart, Brille, sich stets erneuernder Vorhaut und "verfrüht" kommt er zur Welt, ist also Moses und nicht Jesus. In dieser Nacht klopft es an die Tür. Ein Hausierer will Hosen verkaufen. Die Familie Israelien weist ihn ab, obwohl er einer der 36 Gerechten sein könnte. Dieses Klopfen war "keine klassische Witzeröffnung, keine Pointe, ein Klopfen, das keine Spur komisch ist, ganz im Gegenteil. Invers." Denn in der Nacht der zehnten Plage war er der Todesengel, der an den Häusern der Israeliten vorübergeht.
Ein satirischer Amerikaroman zwischen Twain und Kafka.
Invers ist fortan das Schlüsselwort. An Weihnachten sterben alle Juden außer den Erstgeborenen, die auf einer "Garten" genannten Insel vor Manhattan isoliert werden. Bis zum Pessachfest, das an den Auszug aus Ägypten erinnert, sind alle tot. Eine Konversionswelle erfasst Amerika und die Welt. Jüdischsein, am besten orthodox, ist der letzte Schrei. Benjamin, der letzte Jude, weder klug noch religiös, wird von Intriganten in großen Shows durch Amerika getingelt und als Erlöser vermarket. Das gibt Cohen die Möglichkeit, einen satirischen Amerikaroman einzuschieben mit Verbeugungen vor Vorläufern wie Mark Twain, William Gaddis und Thomas Pynchon, aber auch und besonders vor Kafkas "Naturtheater in Oklahoma".
Von unwiderstehlicher Komik sind die Szenen in Los Siegeles (Las Vegas), wo Ben am Vorabend des 4. Juli, des amerikanischen Nationalfeiertags, im Tutanchamen-Amphitheater auftritt. Herrlich ist Bens Flucht vor seinen Vermarktern in die Anonymität der ersten Jahreshauptversammlung der Israelien-Imitatoren, auf der alle Ben sind. Schließlich muss der echte Ben doch seine Identität beweisen. In dieser Szene kombiniert Cohen die kontroverseste Passage aus Saul Bellows Roman "Mr. Sammler's Planet" mit der Geschichte vom ungläubigen Thomas: "Der Mann vom Parkdienst weigert sich zu glauben, dass Ben Ben ist, also . . . zieht [Er] den Goi in eine Ecke und öffnet den Morgenmantel. Eine Beschneidung überzeugt - zumal wenn die Vorhaut die Abscheidung selbst initiiert. Können Sie ruhig anfassen, sagt Er ihm, dran zupfen, schieben und reißen: Das tut nicht weh, Emes [echt] . . ., das ist bloß Haut, die schuppt ab, könnse behalten . . . Geehrt zieht der Mann vom Parkdienst von dannen."
Es folgt der Heimweg nach Osten, der Exodus der neuen Juden nach "Polenland". Cohen verschmilzt eine sarkastische Darstellung des Holocausttourismus mit den im ersten Kapitel etablierten Metaphern für den Holocaust selbst (entrance, arch). Es gilt Inversion. Die Reisenden bestehen darauf, in die Friedhöfe eingelassen zu werden. Die Inschrift über dem Touristentor "ist im Lauf der vielen Jahrhunderte zwölfmal übermalt worden, immer ungefähr dieselben Worte, aber jedes Mal in einer anderen Sprache". Auf der Schulter des einäugigen Wachmanns sitzt "ein Singvogel: Kavka, auch Galka genannt, . . . das geflügelte Symbol der Welt, die seinen Namen erben sollte, Galizien". Zu Galizien gehörte das Herzogtum Oswiecim. Wir sind in Wasimmerwitz. Die Touristen begehren Einlass in seinen Friedhof. Cohen beendet seine Neufassung von Kafkas Parabel "Vor dem Gesetz" mit dem Satz des Türhüters: "Der Friedhof ist die ganze Zeit offen gewesen." Und fügt hinzu: "und ist noch immer offen". In der Tat.
Das pointierte Ende kann nicht verraten werden. Es ist absurd, tragisch und sehr klug. "Witz" ist ein großer Roman. SUSANNE KLINGENSTEIN.
Joshua Cohen: "Witz". Roman.
Aus dem Englischen von Ulrich Blumenbach. Verlag Schöffling & Co., Frankfurt am Main, 2022. 909 S., geb., 38,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main