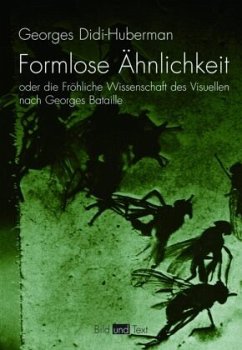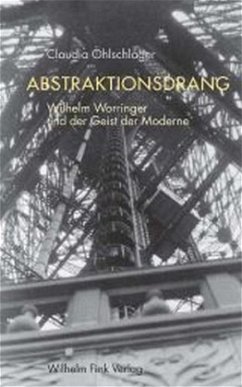Nicht lieferbar

Wo immer vom Sehen die Rede ist ... da ist ein Blinder nicht fern
An den Rändern der Wahrnehmung
Herausgegeben: Boehm, Gottfried; Brandstetter, Gabriele; Stiegler, Bernd
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Die Gestalt des Blinden im Innern der Diskurse um das Sehen markiert die Spur einer Verwerfung. Sie besagt in nuce, dass hier etwas nicht stimmt. In der Tat geschehen an den Rändern der Wahrnehmung seltsame Dinge. Es ereignen sich dort Überlagerungen von Erscheinen und Verschwinden, die auf ein ungewisses Terrain führen. Mediale Settings, wissenschaftliche Instrumente und künstlerische Entwürfe haben sich auf eben dieses Feld begeben, um eine Sichtbarmachung nach der anderen aus dem Dunkeln zu heben und damit auch die Kehrseite des Unternehmens ständig wachzuhalten. Eben davon spricht ei...
Die Gestalt des Blinden im Innern der Diskurse um das Sehen markiert die Spur einer Verwerfung. Sie besagt in nuce, dass hier etwas nicht stimmt. In der Tat geschehen an den Rändern der Wahrnehmung seltsame Dinge. Es ereignen sich dort Überlagerungen von Erscheinen und Verschwinden, die auf ein ungewisses Terrain führen. Mediale Settings, wissenschaftliche Instrumente und künstlerische Entwürfe haben sich auf eben dieses Feld begeben, um eine Sichtbarmachung nach der anderen aus dem Dunkeln zu heben und damit auch die Kehrseite des Unternehmens ständig wachzuhalten. Eben davon spricht ein jedes Blindengleichnis, wie es ältere Generationen in biblischen Texten fanden und wie es das 20. Jahrhundert aus dem physiologischen Labor empfing. Jede Theorie des Sehens hat ihren zugehörigen Blinden, von dem her sie ihre genaueste Charakterisierung erfährt.