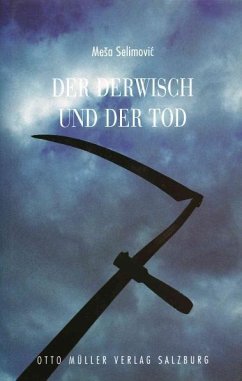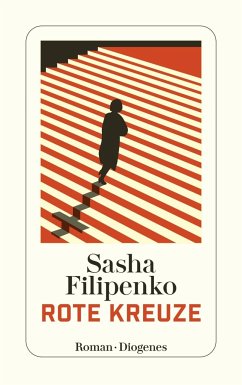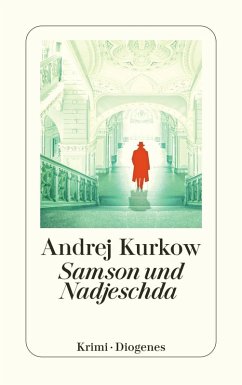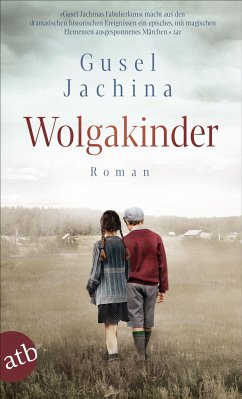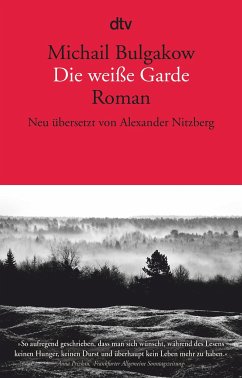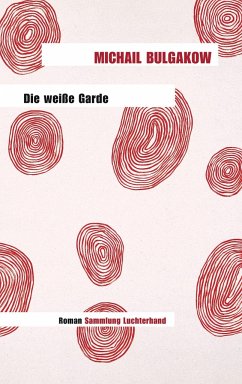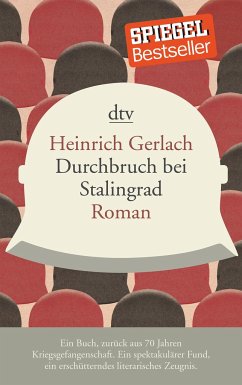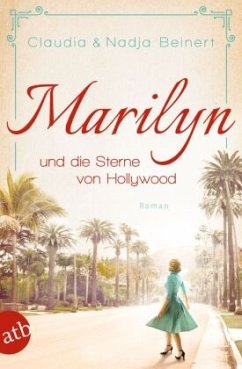Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





»Gusel Jachina ist eine der bedeutendsten Autorinnen der russischen Gegenwartsliteratur.« Ljudmila Ulitzkaja.Kasan 1923: Im Wolgagebiet herrscht große Hungersnot. Dejew, ein ehemaliger Soldat, soll fünfhundert elternlose Kinder mit dem Zug nach Samarkand bringen, um sie vor dem sicheren Tod zu retten. Aber es fehlt an allem für den Transport: Proviant, Kleidung, Heizmaterial für die Lokomotive. Ein Roadmovie durch ein zerrüttetes Land beginnt. Dejew, der selbst ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt, scheut kein Wagnis und keine Gefahr, um die Kinder ins Land des Brotes und der Wund...
»Gusel Jachina ist eine der bedeutendsten Autorinnen der russischen Gegenwartsliteratur.« Ljudmila Ulitzkaja.
Kasan 1923: Im Wolgagebiet herrscht große Hungersnot. Dejew, ein ehemaliger Soldat, soll fünfhundert elternlose Kinder mit dem Zug nach Samarkand bringen, um sie vor dem sicheren Tod zu retten. Aber es fehlt an allem für den Transport: Proviant, Kleidung, Heizmaterial für die Lokomotive. Ein Roadmovie durch ein zerrüttetes Land beginnt. Dejew, der selbst ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt, scheut kein Wagnis und keine Gefahr, um die Kinder ins Land des Brotes und der Wunderbeere Weintraube zu bringen. Ein Sieg der Menschlichkeit in aussichtsloser Lage.
»Gusel Jachinas Buch ist von tiefem Humanismus geprägt.« FAZ.
Kasan 1923: Im Wolgagebiet herrscht große Hungersnot. Dejew, ein ehemaliger Soldat, soll fünfhundert elternlose Kinder mit dem Zug nach Samarkand bringen, um sie vor dem sicheren Tod zu retten. Aber es fehlt an allem für den Transport: Proviant, Kleidung, Heizmaterial für die Lokomotive. Ein Roadmovie durch ein zerrüttetes Land beginnt. Dejew, der selbst ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt, scheut kein Wagnis und keine Gefahr, um die Kinder ins Land des Brotes und der Wunderbeere Weintraube zu bringen. Ein Sieg der Menschlichkeit in aussichtsloser Lage.
»Gusel Jachinas Buch ist von tiefem Humanismus geprägt.« FAZ.
Gusel Jachina, geboren 1977 in Kasan (Tatarstan), russische Autorin tatarischer Abstammung, studierte an der Kasaner Staatlichen Pädagogischen Hochschule Germanistik und Anglistik und absolvierte die Moskauer Filmhochschule. Ihre Romane 'Suleika öffnet die Augen', 'Wolgakinder' und 'Wo vielleicht das Leben wartet' wurden in Dutzende Sprachen übersetzt. Gusel Jachina lebt in Kasachstan. Helmut Ettinger, Dolmetscher und Übersetzer für Russisch, Englisch und Chinesisch. Übersetzte Ilja Ilf und Jewgeni Petrow, Polina Daschkowa, Darja Donzowa, Sinaida Hippius, Gusel Jachina, Michail Gorbatschow, Henry Kissinger und viele andere ins Deutsche.
Produktdetails
- Verlag: Aufbau TB
- Originaltitel: ?????? ?? ?????????
- 1. Auflage
- Seitenzahl: 591
- Erscheinungstermin: 12. Februar 2025
- Deutsch
- Abmessung: 190mm x 115mm x 41mm
- Gewicht: 400g
- ISBN-13: 9783746641522
- ISBN-10: 3746641527
- Artikelnr.: 70306507
Herstellerkennzeichnung
Aufbau Taschenbuch Verlag
Prinzenstraße 85
10969 Berlin
info@aufbau-verlag.de
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Schrecklich ist das, was Cornelia Geißler in Gusel Jachinas "Wo vielleicht das Leben wartet" zu lesen bekommt: Ein Kindertransport soll 1923 in der Sowjetunion 500 Kinder vor dem Hunger in Kasan nach Samarkand bringen, Kinder, denen Fürchterliches widerfahren ist, die zum Teil krank sind, ein Transport, der zum Scheitern verurteilt scheint. Aber: Die Rezensentin empfiehlt das Buch trotz des schwierigen Themas als absolut lesenswert, zeige es doch Menschlichkeit und Hoffnung und ab und zu subtilen Witz. Zudem vermöge es die Autorin, eine vergessene Episode der Geschichte wieder lebendig und damit auch ungelöste Probleme der Gegenwart deutlich zu machen, schließt Geißler.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Warum sollte man das lesen? Weil die Autorin an die Wurzeln der Menschlichkeit geht, weil sie so schreibt, dass man fühlt und begreift, wie sich auch mit diesem Buch ein Vorhang vor so lange verdeckten oder beschönigten Tatsachen hebt.« Frankfurter Rundschau 20230109
Gebundenes Buch
Der ehemalige Soldat Dejew bekommt den Befehl, fünfhundert Kinder von Kinderheimen und Sammelstellen abzuholen und mit dem Zug von Kasan nach Samarkand zu bringen, um diese vor dem Hungertod zu bewahren. Dieser Auftrag ist ungewöhnlich für Dejew, der trotz seines jungen Alters bereits …
Mehr
Der ehemalige Soldat Dejew bekommt den Befehl, fünfhundert Kinder von Kinderheimen und Sammelstellen abzuholen und mit dem Zug von Kasan nach Samarkand zu bringen, um diese vor dem Hungertod zu bewahren. Dieser Auftrag ist ungewöhnlich für Dejew, der trotz seines jungen Alters bereits im Bürgerkrieg gekämpft hat, denn bisher transportierte er Waren und keine Personen, geschweige denn elternlose Kinder. Es ist das Jahr 1923, es herrscht große Hungersnot im Wolgagebiet, genauso wie im restlichen Land. Die Reise steht unter keinem guten Stern, denn es fehlt alles, was man auf einer solchen Reise benötigt. Dejew nimmt die Herausforderung an und kommt schon bald an seine Grenzen.
„Dejew war ein einfacher Mann und liebte einfache Dinge. Zum Beispiel, wenn einer die Wahrheit sagte. Wenn die Sonne aufging. Wenn ein unbekanntes Kind ihm ein sattes, sorgloses Lächeln schenkte. Wenn Frauen sangen, oder auch Männer. Er liebte Alte und Kinder, er war ein Menschenfreund.“ (Seite 91)
Dieses ungewöhnliche Buch lässt mich erschüttert zurück. Ich habe bereits oft am Rande über die Hungersnot in der Sowjetunion gelesen, mich aber nie mit dem Thema beschäftigt. Hier vermischt die Autorin Realität und Fiktion, wodurch eine ergreifende Geschichte entsteht, die so ähnlich tatsächlich passiert sein könnte. Die fremdländischen Namen und Bezeichnungen im Buch wurden nicht alle übersetzt oder erklärt, dies war aber auch nicht nötig. Daneben gab es zudem viele verschiedene Bevölkerungsgruppen, von denen ich noch nie gehört habe, aber auch diese Fülle erschwerte mir die Lektüre nicht. Die Autorin hat eine unglaubliche Gabe, so zu erzählen, dass diese Dinge zwar auffallen, aber den Lesefluss nicht behindern. Hier muss ich aber zusätzlich ein Kompliment an den Übersetzer aussprechen, der großartige Arbeit geleistet hat.
Dejew ist die Hauptperson im Buch, aber da gibt es noch die Kinderkommissarin und Kinder, deren Sicht ich kennenlernen durfte. Dies war, besonders was die Kinder angeht, sehr emotional und stellenweise schwer zu ertragen, weil viele Erlebnisse zwar kindlich und unschuldig vorgetragen wurden, dadurch aber umso schwerer wogen. Es ist ein Unterschied, ob ein Erwachsener oder ein Kind beschreibt, wie ein Toter aussieht, besonders, wenn das Kind nicht wirklich versteht, was das tatsächlich heißt. Diese und anderen Beschreibungen haben mich oft an meine Grenzen gebracht, aber auch das Leid der Kinder und der Umgang mit ihnen haben dazu geführt, dass ich das Buch oft auf die Seite legen und mich förmlich sammeln musste. Auf der anderen Seite gab es aber viele Momente der Hoffnung und des kleinen Glücks, wenn etwa Hilfe erfolgte von einer Seite, von der man es nicht mal hätte erträumen dürfen. Auch der Einfallsreichtum und die Findigkeit von Dejew, der einfach nicht müde wurde, für diese ihm völlig fremden Kinder sein Leben aufs Spiel zu setzen, entlockte mir oft ein Lächeln und, so kitschig es auch klingt, bewirkte eine Wärme im Herzen.
„Vielleicht können wir die Welt tatsächlich so drehen, wie wir es wollen? So verstehen, wie wir es wünschen?“ (Seite 399)
Ein wunderbares Buch über Hoffnung, Menschlichkeit und Liebe und darüber, was es heißt, ein Mensch zu sein. Eine Zeitreise in die Vergangenheit, die mir wieder einmal vor Augen führt, zu was ein Mensch fähig ist, wenn er nur will. Oder auch nicht. Von mir gibt es fünf Sterne mit Sternchen und eine Leseempfehlung.
Weniger
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Anfang der 1920er wurde Russland von einer schweren Hungersnot heimgesucht. Die Nachwehen des Ersten Weltkrieges und der Revolution, politische Entscheidungen, ein schlecht ausgebautes Bahnnetz und eine Trockenperiode kosteten besonders im Wolgagebiet und im Ural Millionen von Menschen ihr Leben. …
Mehr
Anfang der 1920er wurde Russland von einer schweren Hungersnot heimgesucht. Die Nachwehen des Ersten Weltkrieges und der Revolution, politische Entscheidungen, ein schlecht ausgebautes Bahnnetz und eine Trockenperiode kosteten besonders im Wolgagebiet und im Ural Millionen von Menschen ihr Leben.
Kasan 1923. Dejew ist erst in seinen 20ern, aber er hat bereits im Krieg und während der Revolution auf Seiten der Roten Armee gekämpft. Jetzt soll er 500 Kinder mit einem Zug von Kasan in das weniger von der Hungersnot betroffene Samarkand evakuieren. Über 4000 km geht die Reise durch verschneite Landschaften, Steppe und Wüste. In eher schlecht als recht improvisierten Wagons. Zur Seite stehen Dejew dabei neben dem Lokführer und dem Heizer eine Handvoll Frauen aus den unterschiedlichsten Milieus, die sich um die Kinder kümmern sollen, ein Koch, der kein Russisch spricht, ein alter Feldscher und Kommissarin Belaja, die gänzlich andere Vorstellungen von der angemessenen Durchführung des Vorhabens hat, als Dejew. Diese Gruppe ungleicher Erwachsener und ein unzulängliches Gefährt steht zur Verfügung, um 500 traumatisierte, schwer kranke und halb verhungerte Kinder auf eine sechs Wochen lange Reise mitzunehmen. Und die Vorräte reichen gerade mal drei Tage…
Vor einiger Zeit habe ich bereits Gusel Jachinas Roman „Suleika öffnet die Augen“ mit ziemlicher Begeisterung gelesen. „Wo vielleicht das Leben wartet“ hat mir sogar noch besser gefallen. Was Jachina perfekt beherrscht ist, einen in ihre Geschichten mitzunehmen. So wie ich immer noch das Gefühl habe, die Tatarin Suleika auf ihrer Zwangsumsiedlung nach Sibirien begleitet zu haben, so habe ich auch jetzt die Kälte von Kasan und die Hitze der turkmenischen Steppe zu spüren gemeint. Jachinas Sprache spricht alle Sinne an, ist physisch und psychisch.
Besonders an diesem Roman gefesselt hat mich das charakterliche Zusammenspiel der Figuren, die alle dasselbe Ziel haben, aber mit komplett anderen Ansätzen und Überzeugungen agieren. Das schöne ist, dass Jachina es nicht bei den Unterschieden belässt, sondern nach und nach aufdeckt, was hinter den Einstellungen und Handlungen steht, was den einzelnen geformt hat. Dabei ist der Schwerpunkt zwar auf den Erwachsenen, aber auch bei den Kindern kriegen wir Einblicke, die die Tiefe der Traumata erahnen lassen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit „Wo vielleicht das Leben wartet“ einen Kandidaten für mein „Bestes Buch des Jahres“ gefunden habe. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal bei einer Geschichte so mitfiebern konnte. Und ganz nebenbei wurde mein geschichtliches und geografisches Wissen erweitert. Ganz große Leseempfehlung!
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Meinung
Eine Beschreibung der Reise eines Transportzuges von Kasan in das gelobte Land Samarkand, mit 500 Kindern, hungernd, krank, verlassen als Kollateralschaden nach dem Bürgerkrieg in Russland.
Der Roman beschreibt brutal das Leiden der verlassenen Kinder und den Kampf ums …
Mehr
Meinung
Eine Beschreibung der Reise eines Transportzuges von Kasan in das gelobte Land Samarkand, mit 500 Kindern, hungernd, krank, verlassen als Kollateralschaden nach dem Bürgerkrieg in Russland.
Der Roman beschreibt brutal das Leiden der verlassenen Kinder und den Kampf ums Überleben in dem Rettungszug,
Wie die Arche Noah fährt er anderthalb Monate durch ganz Russland und erlebt biblische Abenteuer.
Die Handlung spielt während der schrecklichen Hungersnot in den 1920er Jahren.
Deev, der für den Transport der Kinder nach Samarkand verantwortlich ist, versucht, seine Verbrechen in den Kriegen, an denen er teilgenommen hat, zu sühnen.
Fazit:
Guzel Jahina hat ihren dritten brillanten Roman geschrieben, der sie zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen der Gegenwart zählt,
Ihr Buch hat mich von der ersten bis zur letzten Seite gefangen genommen und ich empfehle es sehr gerne weiter.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Beklemmend und lesenswert
„Die Jagd nach Seife, Verpflegung und Kohle für die Lok brachte nichts, doch Dejew hatte das wichtigste Gesetz des Jägers verstanden, Augen und Ohren stets weit offen zu halten.“ (Zitat Pos. 4387)
Inhalt
Die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges, …
Mehr
Beklemmend und lesenswert
„Die Jagd nach Seife, Verpflegung und Kohle für die Lok brachte nichts, doch Dejew hatte das wichtigste Gesetz des Jägers verstanden, Augen und Ohren stets weit offen zu halten.“ (Zitat Pos. 4387)
Inhalt
Die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges, der Aufstände und des Bürgerkrieges, verbunden mit Ernteausfällen und politischen Entscheidungen, führen in Russland zu einer katastrophalen Hungersnot, bei der Millionen Menschen sterben. Kinder landen in Kinderheimen und Sammelstellen. Fünfhundert dieser Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren soll der Zugführer Dejew von Kasan nach Samarkand bringen, unterstützt von der Kinderkommissarin Belaja. Den Auftrag erhält Dejew am 9. Oktober 1923, doch es gibt keinen Zug, so muss er zuerst eine Lokomotive und Waggons finden. Die Zeit drängt, sollen die Kinder eine Chance haben zu überleben. Die Strecke beträgt mehr als 4.000 Kilometer, die Reise wird mindestens vierzehn Tage dauern und er hat Verpflegung für genau drei, maximal vier Tage bekommen. Doch nicht nur das Essen fehlt, er braucht auch Kleidung, Medikamente für die Kinder, Kohle und Holz für die Lokomotive – es fehlt einfach alles. Doch Dejew, der ehemalige Soldat, der bisher nur Waren transportiert hat, ist fest entschlossen, die Kinder nach Samarkand zu bringen, durch den Bürgerkrieg und unwegsames Gelände, dorthin, wo es genug zu essen geben soll. Seine Ideen und sein persönlicher Einsatz sind waghalsig, kreativ und sehr gefährlich.
Thema und Genre
In diesem Roman mit geschichtlichem Hintergrund geht es um die Hungersnot in Russland in den 1920er Jahren, das Leben der Menschen, vor allem der Kinder. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, Obrigkeit, Mut, Zusammenhalt, Menschlichkeit und Liebe, aber auch um Bürgerkrieg, Gewalt und Vorurteile und auch um Schuld und Sühne.
Charaktere
Als ehemaliger Soldat ist der junge Dejew von seinen Erinnerungen traumatisiert. Er ist mutig, scheut keine Gefahren, verzweifelt, wütend und zornig, wenn es ihm nicht gelingt, die dringend notwendigen Dinge zu erhalten. Er beugt sich keiner Obrigkeit und seine beinahe Vorurteile bleiben auch dort bestehen, wo er auf Menschlichkeit trifft.
Handlung und Schreibstil
Die Geschichte wird chronologisch erzählt, in sieben großen Kapiteln, die als Überschrift jeweils die Anzahl der Menschen tragen, die im Mittelpunkt stehen, und dazu den betreffenden Teil der Strecke. Im Laufe der Handlung ergänzen Erinnerungen der einzelnen Figuren die aktuellen Ereignisse. Diese Vorgeschichten der Figuren zeigen jeweils die eigene Entwicklung, Vergangenheit, prägende Erlebnisse und erklären ihren Charakter näher, ihre Einstellung und Handlungen in der Hauptgeschichte. So wird Verhalten, über das man sich beim Lesen zuvor manchmal gewundert hat, erklärt und nachvollziehbar. Spannende Situationen wechseln ab mit Schilderungen von politischen Hintergründen, des Umfeldes und der Natur, die dieser Zug auf seiner langen Reise durchquert, sowie der Gedanken und Befindlichkeiten der einzelnen Hauptfiguren. Diese ausführlichen Schilderungen und die sich wiederholenden ähnlichen Beschreibungen des Zustandes der hungernden Kinder führen trotz der erschütternden Eindrücklichkeit zu Längen. Denn die Sprache spart nicht mit allen grausamen Details, um dann wieder extrem gefühlsbetont ins Schwülstige zu wechseln. Hier wäre meiner Meinung nach weniger mehr gewesen.
Fazit
Eine eindringlicher, beklemmender Roman, geschrieben gegen das Vergessen. Eine packende Geschichte, interessante Hauptfiguren und faktische Hintergründe, lebhafte, sprachgewaltige Schilderungen, obwohl ich mir gerade hier manchmal eine leisere Sprache gewünscht hätte, machen dieses Buch lesenswert.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
„Wo vielleicht das Leben wartet“ beschreibt die große Hungersnot im Wolgagebiet. Das Jahr 1923 forderte unendlich viele Tote und zahlreiche von ihnen waren Kinder. Das wollen einige Männer ändern und bestimmen den ehemaligen Soldaten Dejew, 500 Kinder mit der Eisenbahn …
Mehr
„Wo vielleicht das Leben wartet“ beschreibt die große Hungersnot im Wolgagebiet. Das Jahr 1923 forderte unendlich viele Tote und zahlreiche von ihnen waren Kinder. Das wollen einige Männer ändern und bestimmen den ehemaligen Soldaten Dejew, 500 Kinder mit der Eisenbahn bis nach Turkestan zu bringen. Der „Marschbefehl“ wurde am 09. Oktober 1923 unterschrieben. Die Reise geht über 4.000 Werst, das sind 4.272 km und wird 6 Wochen dauern. Eigentlich kein Problem in einem warmen Zug mit Schlafplätzen, Küche und Bädern, so wie wir uns das heute vorstellen. Dejew, der schon lange bei der Eisenbahn beschäftigt ist und bereits viele Transporte begleitete weiß, was auf ihn zukommt. Im ersten Moment zögert er daher auch, dem Auftrag zuzustimmen. Er denkt allerdings an die Kinder und will sie auf der weiten Fahrt begleiten.
Es ist der zweite Roman, den ich von Gusel Jachina las. Mir gefällt ihr eigenwilliger Stil und ihre faktenreichen Erzählungen. Wie Dejew zunächst die Wagen zusammensuchen muss, die den Kindern für etliche Wochen ein zuhause sein werden. Wie er die selbstbewusste und harte Genossin Belaja kennenlernt und immer wieder mit ihr aneinandergerät. Wie er sich große Sorgen um die Gesundheit der Schwächsten macht und immer wieder an seine Grenzen kommt.
Kaum Proviant und unterwegs durch ein Gebiet, wo Bürger aufeinander schießen. Immer wieder muss Dejew sich etwas einfallen lassen, um seine Lieben versorgen zu können. Ich fieberte mit ihm und das nur, dank der so lebendig beschriebenen Ereignisse. Wer Gusel Jachina nicht kennt, der wird eine Weile brauchen, bis er der Erzählung folgen kann. Aber für mich ist gewiss, dass es sich für jeden lohnt, dieses Buch zu lesen. Zumal im Jahr 2022 das Thema Russland leider wieder hochaktuell ist.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die Autorin und Filmemacherin Gusel Jachina nimmt uns in ihrem neuen Roman „Wo vielleicht das Leben wartet“ mit zurück in die russische Geschichte.
Kasan, eine Stadt in der Republik Tartastan am Ufer der Wolga. Wir schreiben das Jahr 1923. Der Bürgerkrieg hat unzählige …
Mehr
Die Autorin und Filmemacherin Gusel Jachina nimmt uns in ihrem neuen Roman „Wo vielleicht das Leben wartet“ mit zurück in die russische Geschichte.
Kasan, eine Stadt in der Republik Tartastan am Ufer der Wolga. Wir schreiben das Jahr 1923. Der Bürgerkrieg hat unzählige Opfer gefordert. Viele Kinder haben ihre Eltern verloren. Teils wurden sie getötet, teils haben sie die Kinder ihrem eigenen Schicksal überlassen, weil sie sich nicht mehr imstande sind, sie zu ernähren. Es fehlt an allem, die Lage ist aussichtslos.
Dejew, der ehemalige Rotarmist und jetzt Zugführer bei der Transportabteilung, erhält den Auftrag, 500 bis auf die Knochen abgemagerte Heimkinder im Alter zwischen zwei bis zwölf Jahren in die landwirtschaftlich geprägte Region um Samarkand zu bringen. 4200 Kilometer bis an einen Ort, wo es noch genug zu essen gibt, die Überlebenschancen besser als in der Heimat sind und wo vielleicht das Leben auf sie wartet.
Keine leicht Aufgabe, denn es liegt eine lange und entbehrungsreiche Fahrt durch schwieriges Gelände einem klapprigen Sanitätszug vor ihnen. Es fehlt an Heizmaterial für die Lok, aber auch an Proviant, Medikamenten und Kleidung, selbst Seife ist knapp, aber Not macht erfinderisch und zwischendurch gibt es auch manchmal Hilfe von unerwarteter Seite. Dejew fühlt sich für jedes einzelne Kind verantwortlich und tut alles dafür, dass diese Mission erfolgreich ist. Deshalb handelt er, wenn es die Umstände erfordern, auch gegen die Anweisungen seiner Begleiterin Belaja, einer Moskauer Kommissarin der „Kommission zur Verbesserung des Lebens der Kinder“, die die korrekte Durchführung des Transports überwachen soll und sich ihrem Auftrag und weniger sentimentalen Emotionen verpflichtet fühlt. Aber fünf Wochen sind ein langer Zeitraum, in dem sich viel verändern kann.
Der in Kasan geborenen Autorin ist mit diesem auf historischen Fakten beruhenden Roman ein eindrucksvolles, berührendes Roadmovie gelungen. Sie schreibt gegen das Vergessen an, will die dunklen Kapitel in der Geschichte ihres Heimatlandes aufzeigen. Das ist es, was all ihre Romane kennzeichnet. Dabei wechselt sie gekonnt zwischen an die Nieren gehenden realistischen Beschreibungen und zuversichtlichen, Hoffnung verbreitenden Bildern von tiefer Menschlichkeit. Und ja, man mag es kitschig nennen, aber es sind die empathisch geschilderten Einzelschicksale, die in Erinnerungen bleiben. Die Zuversicht in hoffnungsloser Lage vermitteln und die Bereitschaft zur Verständigung fördern, letzteres die Mission von Gusel Jachina.
Auf den Seiten 572 – 576 sind übrigens die Kosenamen aller Kinder aufgeführt, die nach langer Fahrt wohlbehalten ihr Ziel in Samarkand erreicht haben.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für