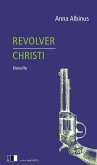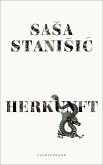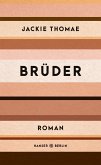Longlist - nominiert für den Deutschen Buchpreis 2019.
In der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1969 betritt Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Abermillionen verfolgen auf der Erde die Fernsehübertragung. Das machen sich einige zunutze. Martha Rohn etwa, wegen Mordes verurteilt, entkommt in jener fernsehstillen Nacht aus dem Frauenzuchthaus, und ihr fünfjähriger Sohn Hardy flieht aus dem Kinderheim, in das er als vermeintliches Waisenkind "Nummer 13" nach ihrer Verurteilung gesteckt wurde. Er weiß nichts über sie, weiß nicht einmal, dass sie noch lebt. Ein Ehepaar nimmt sich seiner an, bietet ihm ein Zuhause in der Neubausiedlung am Kahlen Hang, im Rheingau. Da träumt er davon, eines Tages Astronaut zu werden, und tatsächlich - Jahre später, in Amerika, ist die Verwirklichung des Kindheitstraums zum Greifen nah.
"Wo wir waren", ein breit gefächerter, ein gesamtes Jahrhundert umspannender Roman einer zerrissenen Familie, ist ungeheuer farbig und einfallsreich erzählt, mal rasant, mal nachdenklich, ein großes Tableau, das Zeiten, Länder, Geschichtliches und vor allem eine Vielzahl von Schicksalen verschränkt, von Cliffhanger zu Cliffhanger vorwärtsjagend und dann wieder anrührend und zart. Ein Roman über das Flüchten und Auf-der-Flucht-Sein, über Heimat und Fremde, Zufall und Verwandlung und immer wieder die Frage: Wo waren wir, und wo werden wir einmal sein?
In der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1969 betritt Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Abermillionen verfolgen auf der Erde die Fernsehübertragung. Das machen sich einige zunutze. Martha Rohn etwa, wegen Mordes verurteilt, entkommt in jener fernsehstillen Nacht aus dem Frauenzuchthaus, und ihr fünfjähriger Sohn Hardy flieht aus dem Kinderheim, in das er als vermeintliches Waisenkind "Nummer 13" nach ihrer Verurteilung gesteckt wurde. Er weiß nichts über sie, weiß nicht einmal, dass sie noch lebt. Ein Ehepaar nimmt sich seiner an, bietet ihm ein Zuhause in der Neubausiedlung am Kahlen Hang, im Rheingau. Da träumt er davon, eines Tages Astronaut zu werden, und tatsächlich - Jahre später, in Amerika, ist die Verwirklichung des Kindheitstraums zum Greifen nah.
"Wo wir waren", ein breit gefächerter, ein gesamtes Jahrhundert umspannender Roman einer zerrissenen Familie, ist ungeheuer farbig und einfallsreich erzählt, mal rasant, mal nachdenklich, ein großes Tableau, das Zeiten, Länder, Geschichtliches und vor allem eine Vielzahl von Schicksalen verschränkt, von Cliffhanger zu Cliffhanger vorwärtsjagend und dann wieder anrührend und zart. Ein Roman über das Flüchten und Auf-der-Flucht-Sein, über Heimat und Fremde, Zufall und Verwandlung und immer wieder die Frage: Wo waren wir, und wo werden wir einmal sein?
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Jörg Magenau ist überwältigt von diesem großen Leseabenteuer, das ihm der Schriftsteller Martin Zähringer bereitet. Dass so viel Welt in einen Roman passt, hätte Magenau gar nicht gedacht: Wenn Zähringer die Geschichte des deutschen Waisenjungen Hardy erzählt, der es in einem kometenhaften Aufstieg zum superreichen Internet-Giganten schafft, schlägt einen großen Bogen über Kontinente und Jahrhunderte hinweg. Auf der Suche nach der Essenz des Lebens galoppiert Magenau mit Zähringer durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg, durch Flucht und Vertreibung, Vietnamkrieg und Mondlandung. Magenau erkennt hier deutlich Michael Ondaatje, Thomas Pynchon und "Apokalypse Now" als Referenzpunkte intelligenter Unterhaltungsliteratur. Und auch wenn Zähringer in seinen Augen nicht unbedingt durch stilistische Brillanz glänze, so doch durch eine "federleichte Eleganz".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Zähringer hat seit seinem Debüt "So" bewiesen, dass er ein virtuoser Textilverarbeiter von Handlungsfäden ist. Oder um ein noch passenderes Bild zu bemühen: ein Uhrmachermeister der Literatur. Alle seine Romane sind perfekt konstruierte Minimaschinen, in denen jedes Zahnrädchen ins andere greift, alle Figuren, Motive und Episoden aufeinander abgestimmt sind und kein einziges Detail ohne Funktion. Richard Kämmerlings Die Welt 20190504