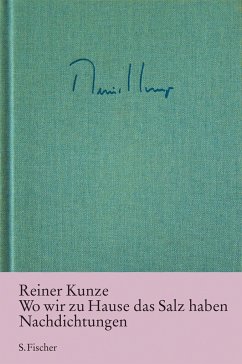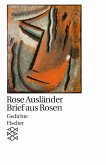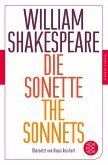"Dichter und Angler gehen verborgenen Geheimnissen nach; dieser dem Fisch, jener dem Vers", schrieb Reiner Kunze 1974. Und da man weder "vom Dichten noch vom Angeln leben kann", angelte der Dichter Reiner Kunze auch immer in fremden Teichen und brachte als Übersetzer so manchen Vers ans Land und entdeckte dem deutschen Leser so manchen fremdsprachigen Dichter.
Unter den Autoren, die so zu seinen Freunden wurden, stach vor allem Jan Skácel hervor, dessen "wundklee" Reiner Kunze kongenial übertrug. Über Jahre hinweg waren Kunzes Übersetzungen die einzigen Veröffentlichungen des in der Tschechoslowakei verbotenen Dichters. Dichten wie Übersetzen waren Formen des Widerstandes und der Rettung.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Unter den Autoren, die so zu seinen Freunden wurden, stach vor allem Jan Skácel hervor, dessen "wundklee" Reiner Kunze kongenial übertrug. Über Jahre hinweg waren Kunzes Übersetzungen die einzigen Veröffentlichungen des in der Tschechoslowakei verbotenen Dichters. Dichten wie Übersetzen waren Formen des Widerstandes und der Rettung.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Peter Demetz sieht in diesen Nachdichtungen "nicht zuletzt Fragmente einer Autobiografie" Reiner Kunzes, denn sie bewahren seiner Ansicht nach "unverwehbare Spuren" von Kunzes Lebensweg auf. Bei der Auswahl der tschechischen Gedichte, die dem Rezensenten zufolge in dieser Auswahl "bei weitem" überwiegen, sieht er außerdem sich ein "verborgenes literarisches Drama" konstituieren, in dem Kunze sich selbst durch ausgeprägte Neigungen näher bestimme. Er übersetze eine berühmte Arbeiterballade Jiri Wolkers ebenso wie Gedichte des älteren Polemikers J.S. Machar und des Melancholikers Karel Torman. Auch jüngere Lyrikerinnen wie Milena Fucimanova hätten in Kunze einen wirksamen Anwalt. Doch den "wunderbaren Zauberer eines spielenden Realismus'" sieht der Rezensent zu seinem Bedauern fehlen, und den Tragiker Frantisek Halas nur mit einem Text vertreten. Dies jedoch tut der Hochschätzung des Rezensenten für Kunzes Auswahl, die auch Übersetzungen aus dem Polnischen, Jiddischen, Slowakischen und Ungarischen einschließt, keinen Abbruch. Vielmehr lobt er dessen sehr eigenen und vielschichtigen Internationalismus und liebt jede von Kunzes Entscheidung für eine poetische Provinz.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Eigenes, das Fremdes bleiben muß: In seinen Nachdichtungen setzt Reiner Kunze seinem mährischen Lieblingspoeten Jan Skácel ein Denkmal - und entwirft Fragmente seiner Autobiographie
Reiner Kunze ist kein wendiger Autor, der leichtfüßig bald das eine, bald das andere publiziert, und da sein loyaler Verlag zu seinem heutigen siebzigsten Geburtstag eine Sammlung älterer und neuerer "Nachdichtungen" veröffentlicht, liegt der Akzent auf der ersten Silbe des Wortes nicht weniger als auf den übrigen. Man spricht von Kunze immer noch als einem "Poeten" oder "Dichter", ob er nun in Greiz in Thüringen wohnte oder, seit mehr als fünfundzwanzig Jahren, in Oberzell-Erlau bei Passau, und auch die interkontinentalen Reisen, nach Afrika, Amerika, Brasilien und anderswohin, um die ihn jeder Reporter beneiden könnte, haben ihm nichts an Konsequenz zu nehmen vermocht. Daran ändern auch die oft kommentierten und öffentlichen "Austritte" nichts, aus der SED, aus der West-Berliner Akademie der Künste, aus dem Verband deutscher Schriftsteller und dem PEN-Zentrum der Bundesrepublik Deutschland. Sie waren nicht als Public-Relations-Aktionen arrangiert, sondern notwendige Akte der Selbstbesinnung. Ein freundlicher Einzelgänger wollte nicht im Gleichschritt marschieren, weder dort noch hier.
Es gibt Übersetzer, die aus Lust an ihren Sprachtalenten arbeiten und sich weder von der Kluft der Jahrhunderte noch von den Traditionsbarrikaden oder den Individualitäten widerstreitender Autoren abschrecken lassen, aber Kunze zählt in seinen "Nachdichtungen" nicht zu ihnen. Er ist weder Dogmatiker noch Asket, denn er übersetzt aus dem Polnischen (zum Beispiel Tadeusz Rózewicz), aus dem Jiddischen (Abraham Sutzkever), aus dem Slowakischen (Laco Novomeský), aus dem Ungarischen (Gyula Illyés oder László Nagy), aus dem Englischen (Michael Hamburger), aber es zieht ihn doch immer wieder zu einer bestimmten Sprache und wenigen Lyrikern hin, in welchen er sich noch einmal verwirklicht findet.
Für ihn ist die paradoxe Annahme, ein anderer Dichter sei wie er selber, keine Torheit. Er sagt ja selbst: "Nachdichten heißt, dasselbe zu schaffen, das ein anderes ist - ein Eigenes, das ein Fremdes bleiben muß"; und daraus fließt auch sein Glaube daran, daß der "übersetzerisch talentierte Dichter" und der "Übersetzer als potentieller Dichter" über die "idealen Voraussetzungen" verfügen, Poesie zu übertragen. Kunze verschweigt dabei, und das tritt in seinen "Nachdichtungen" deutlich zutage, daß er sich zu der historischen Generation seiner Zeitgenossen und unter ihnen wieder zu jenen, deren Leben dem seinen ähnelt, ein um das andere Mal hingezogen fühlt - sobald man seinen mährischen Lieblingsdichter Jan Skácel (1922 bis 1989) ins Auge faßt, die dörfliche Jugend, mit Fluß, Sonne und Vogelkirschen, den bitteren Konflikt mit den Parteizensoren, wechselnde Lichtblicke in einem plötzlichen Tauwetter und dann wieder ein jahrelanges Publikationsverbot. Nicht von ungefähr, daß der Titel der Nachdichtungen, "Wo wir zu Hause das Salz haben", einem Gedicht Skácels entstammt, und der dialogischen Echos, Zitate und Kontrafakturen sind nicht wenige.
Kunzes "Nachdichtungen" sind nicht zuletzt Fragmente einer Autobiographie, denn sie bewahren unverwehbare Spuren seines Lebensweges, und die Auswahl der tschechischen Texte, die bei weitem überwiegen, konstituieren ein verborgenes literarisches Drama, in dem der Übersetzer sich selbst als Poet ausgeprägter Neigungen näher bestimmt. Gewiß: Kunze spinnt sich nicht ein; er übersetzt eine berühmte Arbeiterballade Jirí Wolkers ebenso wie Gedichte des älteren Polemikers J. S. Machar und des Melancholikers Karel Toman, und jüngere Frauen, wie Jana Stroblová oder Milena Fucimanová, die deutschen Lesern noch nicht vertraut sind, haben in ihm einen wirksamen Anwalt. Aber: Vítézslav Nezval, der wunderbare Zauberer eines spielenden Surrealismus, fehlt ganz; der Tragiker Frantisek Halas mit seiner zerfaserten, verletzten Sprache erscheint allein in einem Prosastück. Der fragile und energische Künstler Vladimír Holan ist mit zwanzig Stücken da, der Nobelpreisträger Jaroslav Seifert mit neun, und es dürfte Kunze einige Überwindung gekostet haben, ein Kabarett-Chanson Milan Kunderas (mit leicht schlüpfrigen Wortspielen) aufzunehmen. Im Zentrum der Sammlung steht ohne jeden Zweifel Jan Skácel mit achtundfünfzig Gedichten und sechs Prosastücken - das Mährisch-Gedämpfte, immer ruhig und ernst oder die leere Eifrigkeit der großen Städte, den Blick auf Pfirsiche, Laubfrösche, alte Steine und den Wind mit Namen Jaromír: "Der august so nah wie die distel am weg / Die tage um einen fußbreit kürzer / Unter zerbrechlichem stern bruchstückhafte gespräche / Noch glauben wir's einander nicht dass aus dem nahen dickicht / der herbst tritt / Immerzu liegen die bäume vor anker in wurzeln wie glocken . . . Und wunderschön das überflüssigsein der klage."
Das eine, das auch das andere ist, impliziert nicht allein eine Frage der abstrakten Poetologie. Es verhüllt und offenbart zugleich Wendepunkte in Kunzes Erfahrung und ein merkwürdiges Kapitel der europäischen Dichtungsgeschichte, das über die DDR-Kulturpolitik und die südmährische Abgeschiedenheit hinausreicht. In seiner Seelendürre, im DDR-System, suchte und fand Kunze zu Beginn der sechziger Jahre - und mit Hilfe seiner böhmischen Frau - eine neue poetische Quelle im benachbarten Lande, wo man damals durch ein produktives Tauwetter ging (die kulturpolitischen Rhythmen der DDR und der Tschecheslowakei verliefen nicht immer synchron); kein Sozialistischer Realismus, aber ein neues Frühlingssprießen des tschechischen Poetismus der zwanziger Jahre, allerdings ohne City-Erotik, Revolutionsenthusiasmus und surrealistische Spielerei - mit anderen Worten, ebendas Gedicht Jan Skácels, an dem sich Kunze aufrichtete, das Gedicht eines zentralen Bildes, das seine strahlende Energie in die wenigen und beruhigten Zeilen des Textes ausstrahlt und darüber ins weiße Schweigen, das diese wenigen Zeilen umgibt. Kunze spricht vom "Internationalismus" seiner Lyrik, und er weiß gar nicht, wie recht er hat, denn Skácel, Kunze und der mährische Poetismus sind instinktive Verbündete englischer und amerikanischer poetischer Impulse (1909 bis 1912), die der junge Ezra Pound und Amy Lowell "Imagismus" nannten, sparsame Artikulation, Genauigkeit, die zentrale Metapher im Protest gegen Rhetorik und allzuviel Parfüm.
Kunzes Internationalismus hat verwickelte und vielschichtige Antezedenzien, fernere und nähere, aber das Entscheidende bleibt, daß er sich in seinen poetischen Provinzen niemals einem vermauerten Provinzialismus verschrieb und in einer Epoche fortgesetzter Abneigungen zwischen deutschen und tschechischen Nachbarn wie selten einer auf Sympathie und Einfühlungskraft beharrte. Die frühen Berichte des DDR-Staatssicherheitsdienstes nannten die Studenten, die der junge Dozent Kunze mit seinen selbständigen Gedanken ideologisch auf ketzerische Abwege führte, "Kunzianer", und so einer bin ich, nach meiner Lektüre der "Nachdichtungen", leicht.
Reiner Kunze: "Wo wir zu Hause das Salz haben". Nachdichtungen. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2003. 370 S., geb., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main