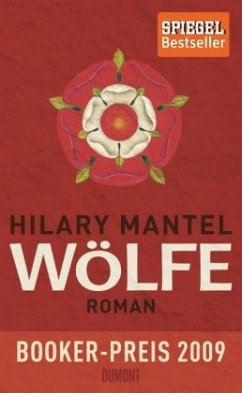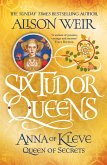The GuardianEngland im Jahr 1520: Das Königreich ist nur einen Pulsschlag von der Katastrophe entfernt. Sollte der König ohne männlichen Erben sterben, würde das Land durch einen Bürgerkrieg verwüstet. Henry VIII. möchte seine Ehe annullieren lassen und Anne Boleyn heiraten. Der Papst und ganz Europa sind dagegen. Die Scheidungsabsichten des Königs schaffen ein Machtvakuum, in das Thomas Cromwell tritt: Die Werkzeuge dieses politischen Genies sind Bestechung, Einschüchterung und Charme. Aus der Asche persönlichen Unglücks steigt er auf und bahnt sich seinen Weg durch die Fallstricke des Hofes, an dem "der Mensch des Menschen Wolf" ist. Hilary Mantel hat mit 'Wölfe' etwas sehr Rares geschaffen: einen wahrhaft großen Roman, der seinem historischen Gewand zum Trotz höchst zeitgemäß ist. Auf einzigartige Weise erforscht er die Choreografie der Macht.
"Hieb- und stichfest ausgedacht und doch voll schauriger Anklänge, stellenweise auch sehr witzig - sobald der Leser dieses 780-Seiten-Buch fertig gelesen hat, will er mehr." The Guardian
"Hieb- und stichfest ausgedacht und doch voll schauriger Anklänge, stellenweise auch sehr witzig - sobald der Leser dieses 780-Seiten-Buch fertig gelesen hat, will er mehr." The Guardian

In diesem Bücherherbst ist das Rennen noch offen. Elf Romane, auf die man sich schon jetzt freuen kann - und ein Tagebuch.
Wir leben im Zeitalter der Selbstversuche: Geht es auch mal ohne Handy, Internet, Auto, Kaffee, Alkohol, High Heels? Während die große Urlaubsfrage für viele zu sein scheint: Laptop einpacken - oder mutiger Entzug vom Netz?, kommt niemand ernstlich auf die Idee, ohne Bücher in die Ferien zu fahren. Im Gegensatz zu fast allem anderen Zeitvertreib gibt es beim Lesen von Literatur kein Zuviel. Nur: was?
Eines schönen Herbstmorgens, als sie auf der Suche nach einem Buch in ihren gut gefüllten Regalen über Dutzende von Bänden stolperte, die sie schon lange nicht mehr abgestaubt, geschweige denn gelesen hatte oder die sie, wie ihr da bewusst wurde, eigentlich gern ein zweites Mal lesen würde, beschloss die englische Schriftstellerin Susan Hill, ein Jahr lang keine neuen Bücher mehr zu kaufen, sondern ausschließlich die zu lesen, die sie schon besaß. Ihr sehr persönlicher, ausschweifender Erfahrungsbericht vom Wiederlesen alter Lieblinge und Neuentdecken mancher Klassiker, "Howards End is on the Landing" (Profile Books, 2009), mag Buchhändlern, Verlegern und Agenten als Häresie erscheinen, macht aber Lust, ihrem Beispiel zu folgen - wenngleich er die Wirkung einer Einkaufsliste hat: Das möchte ich auch alles lesen.
Aber der neue Herbst steht vor der Tür. Der letzte war eine an überragenden Werken - man nehme nur Herta Müller, David Foster Wallace, Roberto Bolaño - außergewöhnlich reiche Saison (F.A.Z. vom 17. Juli 2009). Was solche Instant-Klassiker-Dichte angeht, kann der neue Bücherherbst zwar nicht mithalten. Wenn aber die Titel fehlen, an denen man nicht vorbeikommt, lassen sich umso mehr Entdeckungen machen. Zum Beispiel dürfen wir uns schon einmal auf zwölf aparte neue Erscheinungen freuen.
Auf die Gipfel deutscher Erzählkunst spaziert Martin Mosebach mit unnachahmlicher Eleganz und Leichtigkeit. In seinem Roman "Was davor geschah" (Hanser, 16. August) erzählt er davon, dass mitunter zwei Paare auseinandergehen müssen, damit ein drittes entstehen kann, während ein weiteres über der rückblickenden gemeinsamen Betrachtung dieser Commedia dell'Arte zusammenfindet. Eigentlich aber handelt auch dieser Roman des Frankfurter Autors von den Versuchen der Menschen, mit Hilfe der Form ihre Natur zu überwinden - und der Erkenntnis, dass ihnen dies selbst bei größten Zivilisierungsanstrengungen nie dauerhaft gelingen wird. Nur durch die Kunst, so begreifen wir beim Lesen dieses meisterlich komponierten Werks, lassen sich in diesem ewigen Kampf Etappensiege erzielen.
Für viel Gesprächsstoff wird Fritz J. Raddatz sorgen, der in seinen "Tagebüchern 1982 - 2001" (Rowohlt, 17. September) großartige Innenansichten der Jahre, die wir kennen, liefert. Wenn nicht gerade selbst im Zentrum des Geschehens, dann doch nie weit davon entfernt, gehört Raddatz nicht zu jenen Tagebuchschreibern, die sich als Chronisten verstehen. Er ist ein Mann der Hauptsachen, der Hauptpersonen und der Hauptgerüchte. Alle, wirklich alle, die im literarischen Leben dieser Zeit etwas zu melden hatten, kommen vor - und noch viele andere. Sei es die jahrzehntelang enge, letztlich aber doch enttäuschende Freundschaft mit Günter Grass oder der unglaublich eitle Hans Mayer, Marion Gräfin Dönhoff, Helmut Schmidt oder andere seiner Kollegen von der "Zeit" - für die literarische Republik dürften die Tagebücher von Raddatz das werden, was Dietls "Kir Royal" in den achtziger Jahren für München war: Kult- und Hassobjekt zugleich.
Wann immer es ihm zu doll wird, zieht Raddatz sich nach Sylt zurück. Dort verbringt auch Verlagsvertreter und Teilzeitvater Peter eine Ferienwoche mit seiner heranwachsenden Tochter. Thomas Hettche stellt sich in "Die Liebe der Väter" (Kiepenheuer & Witsch, 19. August) der ungeheuren Frage, wie viel Vater man sein kann, wenn man sein Kind nur selten sieht. Dass die Antwort darauf immer wieder neu gesucht und gefunden werden muss, macht die Integrität dieses Romans aus, der sich nebenbei auch als Nachruf auf unsere Buchkultur lesen lässt.
Der Berliner Strafverteidiger Ferdinand von Schirach setzt seine im vergangenen Herbst mit "Verbrechen" fulminant begonnene literarische Karriere mit "Schuld" nahtlos fort (Piper, 2. August). Seine knappen, auf den Punkt erzählten Stories beziehen ihre Wucht aus der Berufserfahrung des Autors, ihre Intensität hingegen aus seinem schnörkellosen Stil - und der Erkenntnis, dass das Gesetz niemandem die moralische Verantwortung abnimmt, bisweilen am wenigsten dem, der es vertritt.
Gleich mehrere der stärksten Romane dieses Herbstes kommen aus Großbritannien. Hilary Mantels "Wölfe" (Dumont, 23. August), die Geschichte vom Aufstieg Thomas Cromwells zum Berater des politisch verblutenden Heinrichs VIII. und infolgedessen zur prägenden Gestalt im England des sechzehnten Jahrhunderts, wurde dort im vergangenen Jahr verdient mit dem Booker-Preis ausgezeichnet und sollte die Autorin nun endlich auch bei uns bekannt machen. Indem sie die Machtkämpfe zwischen Cromwell, Thomas More und Kardinal Wolsey nicht nur mit souveräner Kennerschaft, sondern auch mit subjektiver Charakterdeutung nachzeichnet, verwandelt Mantel den historischen Stoff in ein großes Stück Gegenwartsliteratur. Ihr Cromwell, Sohn eines Schmieds aus Putney, der den Krieg in Frankreich, das Geldgeschäft in Florenz und den Handel in Antwerpen kennengelernt hat, hält insgeheim zu den Protestanten. Wer glaubt, aus der sicheren Distanz von fünf Jahrhunderten gegenüber den Handelnden im Vorteil zu sein, wird eines Besseren belehrt.
Der fünfundfünfzigjährige Ire Colm Tóibín, der sich mit seinem Henry-James-Roman "Porträt des Meisters in mittleren Jahren" (2005) auch hierzulande als herausragender Autor seiner Generation etabliert hat, erzählt in "Brooklyn" (Hanser, 6. September) von der jungen Eilis, die auf Drängen ihrer Schwester die ärmlichen Verhältnisse, aber auch die Sicherheit ihres südirischen Städtchens aufgibt und nach Amerika geht. Mit der aufrechten, intelligenten Eilis hat Tóibín eine Figur geschaffen, die den Leser nicht mehr loslässt. Vor allem aber ist sein Roman, getragen von einem Ton stiller Selbstverständlichkeit, eine ergreifende Meditation über Fremdheit, Heimweh, den Preis der Selbstbehauptung und das Vergehen der Zeit.
Wer es bunt, schnell, aufgeregt und anstößig mag, wird bei Adam Thirlwell auf seine Kosten kommen. Wie bereits in seinem bemerkenswerten Debüt "Strategie" (2004) geht es auch im neuen und drittem Roman des 1978 geborenen Engländers, "Flüchtig" (S. Fischer, 8. September), um die Lust des verdoppelten Zuschauens. Wir betrachten Haffner, den Helden, in einem alpinen Resort beim Betrachten des ihm entgleitenden Lebens. Aber Haffner, Ende siebzig, Londoner Jude, vermögender Banker und kürzlich verwitwet, ist noch nicht bereit, seinen Lastern - Frauen, Jazz, Cricket - abzuschwören. Auch wenn dem betagten, doch gänzlich unverzagten Helden dieses spritzigen Romans in seiner Liebe zu der Yogalehrerin Zinka nicht viel anderes übrigbleibt, als durchs Schlüsselloch gleichsam frustriert auf sein Leben zu spähen, ist das Resultat alles andere als ernüchternd. Thirlwells neues Buch besticht, wie schon die vorigen, vor allem als Experiment, das seinen Helden als Folie für erzählerische Extravaganzen und stilistische Ertüchtigung benutzt.
Ian McEwan betritt mit jedem seiner Romane Neuland, thematisch wie stilistisch. "Solar" (Diogenes, 27. September) beschäftigt sich in der tragikomischen Gestalt von Physik-Nobelpreisträger Michael Beard mit der Forscherszene rund um den Klimawandel, erzählt aber vor allem davon, dass der Mensch noch so ausgebufft sein kann - seine inneren Schweinehunde in Form von Bequemlichkeit, Gier, Gefallsucht und Eitelkeit werden ihm fast immer einen Strich noch durch die schlaueste Rechnung machen. Aus einem vermeintlich trockenen, schwierigen Thema macht Großmeister McEwan den brillantesten, witzigsten Roman der Saison.
"Die Unperfekten", das in Amerika bereits gefeierte Romandebüt des Kanadiers Tom Rachman (dtv Premium, 15. September), erzählt auf höchst originelle Weise vom allmählichen, doch unaufhaltsamen Niedergang einer internationalen Tageszeitung mit Sitz in Rom. Das Szenario, geschildert aus der kapitelweise wechselnden Perspektive der Beteiligten und Betroffenen, entfaltet neben unbedingter Melancholie indes auch anrührende Komik. Denn vom abgehalfterten Korrespondenten in Paris über die frustrierte Wirtschaftsreporterin, den besonnenen Chefkorrektor und eine habituell gestresste Chefredakteurin bis zum unfähigen panikstarren Verleger entwirft Rachman, ehemaliger Redakteur der "International Herald Tribune", ein denkwürdiges Panoptikum von Individualisten.
Der New Yorker David Levithan dekliniert in seinem "Wörterbuch der Liebenden" von A wie abwegig (",Normalerweise tu ich so was nicht', sagtest du.") bis Z wie Zenit ("Das ist er, der Augenblick, bevor du mir genau das erzählst, was ich nicht hören will.") ein vertrautes Gefühl in ungewöhnlichen Stichworten (Graf Verlag, 13. August). Und zu guter Letzt beschert uns die amerikanische Literatur noch ein großes Geheimnis: "Freedom", Jonathan Franzens ersten Roman seit den "Korrekturen" (Rowohlt, 17. September). Im Fall dieses Autors dürfte sich das Warten aller Wahrscheinlichkeit nach lohnen.
Argentinien, Heimat größter literarischen Einbildungskraft und Gastland der diesjährigen Buchmesse, verheißt außergewöhnliche Entdeckungen. Einen ersten Vorgeschmack gibt "Geschichte der Tränen" von Alan Pauls (Klett-Cotta, 20. August), ein im Supermankostüm eines rasanten Bewusstseinsmonologs getarnter Blick auf die verdrängte politische Vergangenheit. Und im November schließlich, einen Monat nach der Messe, gibt der hundertste Todestag Leo Tolstois dann all jenen, die es vielleicht doch Susan Hill nachtun möchten, den denkbar besten Grund, die Neuerscheinungen zugunsten dieses Klassikers unter den Klassikern zu überspringen.
FELICITAS VON LOVENBERG
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit sichtlich genauer Kenntnis der historischen Zusammenhänge sowie mit allergrößter Anerkennung für das Können von Hilary Mantel schreibt Rezensent Markus Gasser über diesen historischen Roman. Wobei er gleich jeden abfälligen Gedanken über das Genre als solches beiseite schiebt: Hier sei, und zwar erstmals und endlich, der historische Roman wirklich auf der Höhe der literarischen Moderne a la Virginia Woolf. Es geht in diesem Band, dem eine Fortsetzung folgen wird, um die Figur des Thomas Cromwell, der aus niedrigen Verhältnissen kam, Schatzkanzler erst, dann persönlicher Sekretär Heinrichs des VIII. wurde, um dann doch in jene Sorte Ungnade zu fallen, die zur Folge hat, dass der eigene Kopf auf einer Pike zur Freude der ganzen Stadt ausgestellt wird. Sehr viel eher als jüngere historische Literatur werde Mantel dabei der stets um Moderation bemühten Figur Cromwells gerecht. Literarisch sei das Drama von geradezu "shakespearescher Wucht" und darum eine dringende Empfehlung auch für jeden, der dem Genre sonst mit Skepsis oder schlimmerem zu begegnen pflegt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ein Wunder von einem Roman." FAZ "Ein preisgekröntes Meisterwerk (...). Eine Sensation (...). Hilary Mantel schreibt schnörkellos, präzise und findet immer wieder überraschend poetische Bilder" BRIGITTE "Zum Verschlingen!" COSMOPOLITAN "Ein literarischer Leckerbissen für alle Liebhaber historischer Romane." NDR Kultur (,Buch der Woche') "Wölfe macht die Welt Heinrich des VIII. begehbar!" DIE WELT "Der gewöhnliche historische Roman verhunzt sowohl die Geschichte, als auch die Literatur. In Wölfe haben beide einen Festtag. (...) Hilary Mantel, die viel Gepriesene, hat ein Teilreich der Literatur erneuert: den historischen Roman." FAS "Ein Porträt von Mensch und Zeit (...) als bedrängend empfundene Gegenwart, die in jedem Moment nach Aufmerksamkeit verlangt, nach Misstrauen, nicht zuletzt auch nach weitblickenden Zielvorstellungen über das Dunkel des erlebten Moments hinaus. Und ihre klaren Sätze ohne historisierenden Zierrat, von Christine Trabant in ein genauso klares Deutsch übertragen, verstärken diese Wirkung noch." NZZ "Die Wölfe sind anders, besser, aufregend, aufwühlend, und sie rufen nach einer Fortsetzung." WAZ "Wölfe unterstreicht, dass literarische Meisterwerke auch vor historischer Kulisse funktionieren (...) große Kunst - ein Highlight des Bücherherbstes." BUCHJOURNAL "Mantels historischer Wälzer ist anders, besser" KULTURSPIEGEL "Fein gewebt aus Anspielungen, Verweisen sowie einer subtilen Psychologie ist diese Geschichte von Verführung, Verrat und gewaltsamen Tod ein spannender Roman, der vorzüglich amüsiert und gleichzeitig aufs Schönste bildet." DEUTSCHLANDRADIO KULTUR "Überall lauscht man gebannt Dialogen, die gefährlich, intim, böse witzig, elegant modern, pointiert sind (...) ein brillanter historischer Roman, eher ein sinnliches Denk- als ein Lehrstück über Macht und Vergeblichkeit. 760 Seiten im Präsens geschrieben - nicht nur das macht seine Gegenwärtigkeit aus." FRANKFURTER RUNDSCHAU "Ein Meisterwerk des historischen Romans." TAGESANZEIGER "Ein atemberaubend intelligent geschriebenes Historienpanorama." Sigrid Löffler (Kulturradio-Tipps RBB) "Ein wunderbares Stück historischer Literatur." KÖLNER STADTANZEIGER "...ein Werk von shakespearescher Größe und Wucht, und zugleich ein durch und durch moderner Roman" BERLINER ZEITUNG "Ein exquisites Beispiel von Erzählkunst" BUCHKULTUR "Sie nähert sich der modernen, geistreichen und blutrünstigen englischen Renaissance im besten Stile eines packenden, seriösen historischen Romans mit höchstem literarischem Anspruch." ABENDZEITUNG