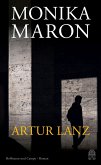Nach dem Tod seiner Frau - seiner ersten Frau - ist er von London nach Paris gezogen, später mit seiner Frau - seiner zweiten - von Paris nach Wales. Egal wo, er lebt zurückgezogen, als Übersetzer aus dem Französischen, als Liebhaber von Musik und Literatur, ein Kenner mit Meinungen und ein Mann von ausgeprägten Gewohnheiten und Routinen.Was er ist, ist er scheinbar immer schon gewesen, was er tut, tut er länger, als er sich erinnern kann, und wie er es nie anders getan hat. Aber warum? Vielleicht nur, weil es etwas in seinem Leben - seinem Vorleben - gibt, an das er sich nicht erinnern will? Etwas, vor dem einen keine Kunst auf Dauer ein Versteck bietet. Oder besser: Schon gar nicht die Kunst!Gabriel Josipovici gilt als »englischer Thomas Bernhard « und bestätigt diesen Ruf auch mit seinem jüngsten Buch. Es erzählt auf überraschend unterhaltsame Weise vom Leben und Lassen eines klugen Mannes an der Seite seiner Frau.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Dieses Buch scheint für Rezensent Tim Caspar Boehme eine gewisse Altersmürbe auszustrahlen, eine Feinheit, Distanz und Freundlichkeit, denen er mit ebensolchen Worten seinerseits Ausdruck verleiht. Es geht um das Leben eines alten Übersetzers, wie es ja, so erinnert uns der Kritiker, auch der Autor selbst ist. Sein Leben hat er offenbar mit literarischen Obsessionen verbracht, von denen ihn eine spöttische "zweite Frau" immer wieder einmal erlöst. Zwar bleibt der Protagonist ein "zurückhaltender Beobachter", aber seiner Mitteilungsfreude tut das, so scheint es, keinen Abbruch. Und für seinen Teil hat dieser Kritiker all dem sehr gerne gelauscht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Gabriel Josipovicis "Wohin gehst du, mein Leben?"
Titel geben Büchern mitunter eine andere Richtung, wenn sie aus einer fremden Sprache übersetzt werden. Der neue Roman von Gabriel Josipovici heißt im englischen Original "The cemetery in Barnes" (Der Friedhof in Barnes), im Deutschen aber "Wohin gehst du, mein Leben?" Der Stadtteil Barnes im Südwesten Londons, dessen "geheimnisvoll verlassenen und verwilderten Friedhof" der namenlose Protagonist gerne aufsucht, dürfte den meisten deutschen Lesern, auch wenn dort ein paar Halbberühmtheiten begraben liegen, wenig sagen, anders als der Vers "Dove t'en vai, mia vita?" aus Monteverdis Oper "L'Orfeo", die den Roman poetisch interpunktiert. An die Stelle der letzten Ruhestätte tritt eine Frage zum offenen Verlauf des Lebens. Das klingt attraktiver und macht eher neugierig, ist aber noch mehr: eine Fortsetzung des Themas, denn das Buch handelt auch vom Übersetzen - von dessen Freiheit und Schönheit, Einsamkeit und Qual.
Ein nicht mehr junger Mann, Musikliebhaber und passionierter Spaziergänger, ist nach dem Tod seiner Frau von London nach Paris gezogen, wo er eine Mansarde mit Blick aufs Pantheon bewohnt und übersetzt. Er ist "ein altmodischer Typ", trägt Jackett und Krawatte bei der Arbeit, immer Hut, wenn er ausgeht, und hält einen geregelten Tagesablauf ein: "Ein Gewohnheitstier." So wird er vorgestellt, doch nach drei Seiten unterbricht ihn seine Frau, "seine zweite Frau", wie sie fortan apostrophiert wird, mit der er in einem umgebauten Bauernhaus in den Black Mountains oberhalb von Abergavenny in Wales lebt. Freunde und Nachbarn kommen hier häufig zu Besuch, und er erzählt, im eingespielten Geplänkel mit seiner zweiten Frau, Geschichten aus den Pariser Jahren und bald auch vom Leben mit der ersten Frau, "einer Anwältin in Ausbildung und Amateurgeigerin", in Putney, dem Nachbarort von Barnes.
London, Paris, Wales. Drei Orte, drei Zeiten, drei Lebensabschnitte. Gabriel Josipovici, der 1940 als Kind russisch-italienischer und rumänisch-levantinischer Eltern in Nizza geboren wurde, in Kairo aufwuchs, in Oxford studierte und 35 Jahre an der University of Sussex lehrte, ist ein unberechenbarer Autor: Er folgt nicht der Chronologie, sondern wechselt oft unvermittelt die Ebenen, springt vor und zurück, verschränkt und verwebt sie, hebt die Differenz zwischen Er- und Ich-Erzähler stellenweise auf, korrigiert und widerspricht sich. Mit kleinen Irritationen, Abweichungen, Wachträumen und (Männer-)Phantasien verunsichert er den Leser, die erzählte Wirklichkeit gerät in die Schwebe: Sie erscheint als "nur" eine Möglichkeit unter vielen, unzuverlässig wie die Erinnerung und anfällig für Verschiebungen, Lücken, Variationen, Wiederholungen. Der Text nimmt sie auf, seine Gemachtheit wird Thema. Der Leser muss die "richtige" zeitliche Abfolge selbst erschließen und kommt ins Grübeln: Kann es sein, dass es sich bei der ersten Frau und der Frau, die der Mann als (auf Abstand bleibender) Stalker verfolgt, um ein und dieselbe Person handelt? Und ist die erste Frau "wirklich" dreimal in die Themse gefallen und, während er am Ufer saß und scheinbar teilnahmslos zusah, ertrunken?
Der kleine Roman wird zur Reflexion über die Gattung, ihre Grenzen und Möglichkeiten, zum Metaroman: "In dem einen Leben sind viele Leben. Andere Leben. Einige wurden gelebt und andere sind eingebildet. Das ist das Absurde an Biographien, würde er sagen, an Romanen. Sie ziehen nie die anderen Leben in Betracht, die ihre Schatten über uns werfen, während wir uns allmählich, wie im Traum von der Geburt zur Reife und zum Tod bewegen." Die zweite Frau, ein etwas schlichtes Gemüt, aber mit Witz und Selbstironie, formuliert es so: "Vielleicht. Das ist sein Lieblingswort" - Synonym dafür, dass es auch anders sein kann.
Der Roman ist nicht die Biographie, die Literatur nicht das Leben. Das mag ein Gemeinplatz sein, doch sind sie ständig in Gefahr, verwechselt zu werden. Die Literatur kann mehr als die Wirklichkeit nur abbilden. Was sie vermag und was nicht, wird auch an den Übersetzungen ablesbar: Die "immer gleichen Pappmachéromane mit den immer gleichen Pappmachéhandlungen", die der Protagonist übersetzt, können Erstickungsgefühle auslösen, die Sonette von Joachim du Bellay, die ihn nicht loslassen und ihm als Übersetzer unerreichbar sind, schlaflose Nächte bereiten. Mit dem Kompositionswitz und den Ungereimtheiten, die er aufbietet, pfeift Gabriel Josipovici virtuos auf eine englische Erzähltradition, die alle Erschütterungen durch die Moderne überstanden hat. "Wohin gehst du, mein Leben?" ist ein unauffällig raffiniertes Loblied auf die Poesie, eine Spitze, ironisch und irritierend, gegen die Leseroutine. Nichts für Gewohnheitstiere.
ANDREAS ROSSMANN
Gabriel Josipovici: "Wohin gehst du, mein Leben?" Roman.
Aus dem Englischen von Jochen Jung. Verlag Jung und Jung, Salzburg 2020. 110 S., geb., 18,- [Euro]
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main