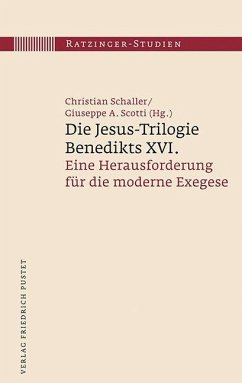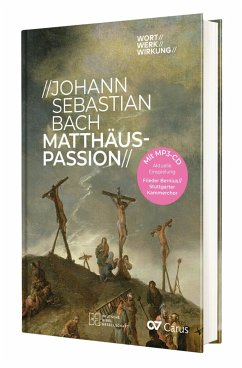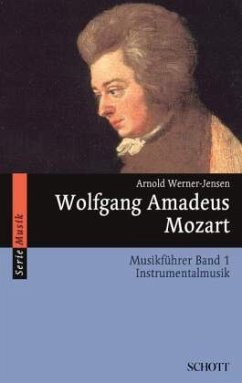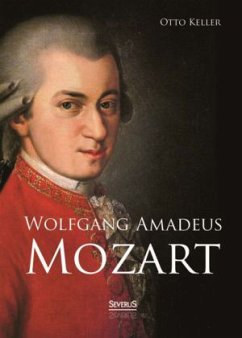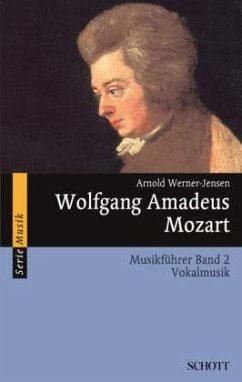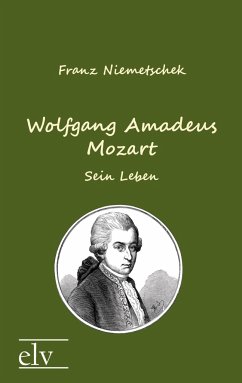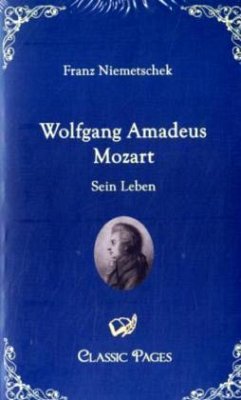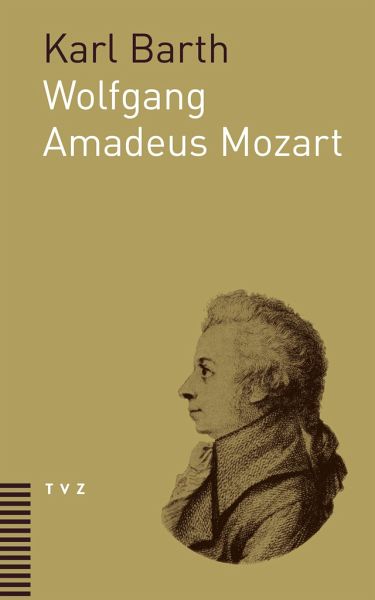
Wolfgang Amadeus Mozart
1756/1956
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
15,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ich habe zu bekennen, daß ich (dank der nicht genug zu preisenden Erfindung des Grammophons) seit Jahren und Jahren jeden Morgen zunächst Mozart höre und mich dann erst (von der Tageszeitung nicht zu reden) der Dogmatik zuwende. Ich habe sogar zu bekennen, daß ich, wenn ich je in den Himmel kommen sollte, mich dort zunächst nach Mozart und dann erst nach Augustin und Thomas, nach Luther, Calvin und Schleiermacher erkundigen würde. Karl Barth