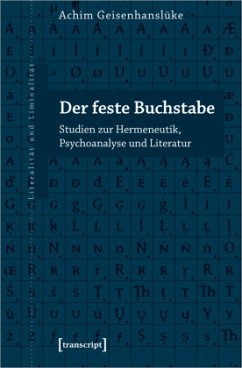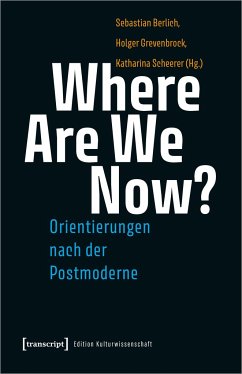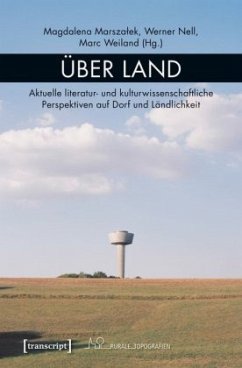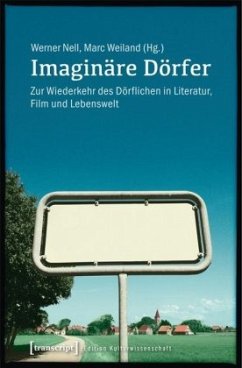Nicht lieferbar

Wolfsmänner
Zur Geschichte einer schwierigen Figur
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Von Ovid bis Freud, von Canetti bis Deleuze/Guattari - Achim Geisenhanslüke setzt sich mit den seit der Antike überlieferten Figuren der Wolfsmänner auseinander und entwickelt eine Theoriegeschichte dieser sagenumwobenen Mischwesen. Die Analyse wird durch den ständigen Einbezug literarischer Texte u.a. von Schiller, Goethe, Stifter, Storm, Canetti, Hesse, London und Kipling sowie filmischer Überlieferungen ergänzt.Der Band ist für Literaturwissenschaftler ebenso interessant wie für Medien- und Filmwissenschaftler, darüber hinaus aber auch für ein breiteres Publikum lesenswert.
Von Ovid bis Freud, von Canetti bis Deleuze/Guattari - Achim Geisenhanslüke setzt sich mit den seit der Antike überlieferten Figuren der Wolfsmänner auseinander und entwickelt eine Theoriegeschichte dieser sagenumwobenen Mischwesen. Die Analyse wird durch den ständigen Einbezug literarischer Texte u.a. von Schiller, Goethe, Stifter, Storm, Canetti, Hesse, London und Kipling sowie filmischer Überlieferungen ergänzt.
Der Band ist für Literaturwissenschaftler ebenso interessant wie für Medien- und Filmwissenschaftler, darüber hinaus aber auch für ein breiteres Publikum lesenswert.
Der Band ist für Literaturwissenschaftler ebenso interessant wie für Medien- und Filmwissenschaftler, darüber hinaus aber auch für ein breiteres Publikum lesenswert.