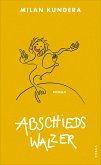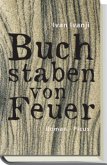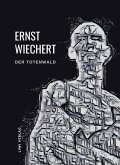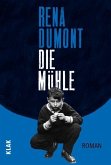"Wolke und Walzer" ist eine der ersten unmittelbaren Auseinandersetzungen mit dem nationalsozialistischen Terror in literarischer Form. In einem breit angelegten Panorama, in dem Täter, Opfer, Mitläufer und Gegner an zahlreichen europäischen Schauplätzen auftreten, erzählt der Roman vom Einbruch des Totalitarismus. Ferdinand Peroutkas persönliche Erlebnisse im Konzentrationslager Buchenwald nehmen dabei eine zentrale Stellung ein.Zum 70. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus erscheint der Roman erstmals in deutscher Übersetzung.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Als europäischen Jahrhundertroman bezeichnet Hans-Peter Kunisch Ferdinand Peroutkas bereits 1976 in Toronto erschienenen Roman. Beeindruckt hat Kunisch vor allem der Auftakt, da der Autor den Leser schön auflaufen lässt. Bis Peroutka ihn "brüsk" weckt, hat der Rezensent sich nämlich eingefühlt in den abgerissenen Kunstmaler X. Dahinter aber verbirgt sich, das merkt der Rezensent mit Schrecken, niemand anderes als Adolf Hitler. So raffiniert der Auftakt, meint Kunisch, so ganz anders der weitere Verlauf des Romans, da der Autor Montagetechnik, Zeit-, Orts- und Perspektivwechsel und jede Menge Ironie anwendet, um die Handlung und seinen Figurenreigen aus verfolgten Juden, Kommunisten und Nazis in Bewegung zu halten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Václav Havel hielt ihn für einen der besten tschechischen Romane: Ferdinand Peroutkas "Wolke und Walzer" schildert die Zeit der deutschen Okkupation im Zweiten Weltkrieg mit scheinbarer Objektivität, hinter der sich doch Moral verbirgt.
Im Prolog zu seinem Roman "Wolke und Walzer" lässt Ferdinand Peroutka einen abgerissenen jungen Mann im Jahre 1910/11 durch Wien irren. Er nennt ihn nicht beim Namen, sondern bezeichnet ihn mit einem Buchstaben: "X".
Der Mann versucht ein paar Zeichnungen in einer Redaktion zu verkaufen, erfolglos, und wartet vor einem Lokal auf einen Bekannten, der nicht erscheint. Schließlich stellt er sich in die Schlange der Armseligen vor dem Nachtasyl. Hier muss er sich mit seinem Namen registrieren lassen. Der junge Mann schreibt: "Hitler, Adolf".
Wie ein Menetekel, eine schwarze Sonne, steht dieser Name über dem Roman, der vielleicht gar kein Roman ist, sondern eine literarische Tatsachenbeschreibung einer Fahrt in die Hölle. Wir verfolgen die Schicksale einiger Prager Einwohner, die nach der Okkupation ihres Landes durch die Deutschen in diese Hölle geraten. Juden wie die Bankangestellten Kraus und Kohn, der Arzt Dr. Pokorny und seine Frau Eva; sie treffen sich regelmäßig im Restaurant "Baroque" zum Kartenspiel, niemand von ihnen ahnt etwas von dem Schicksal, das ihnen bevorsteht. Mit der Besetzung der Tschechoslowakei im Jahre 1939 bricht ihr bisheriges Leben zusammen.
Es wäre sinnlos, die Biographien dieser Menschen zu beschreiben, denn sie sind in keiner Weise selbst für das verantwortlich, was ihnen widerfährt. Es geht also nur darum, wie jemand sich verhält, wenn er mit etwas für ihn vollkommen Unbegreiflichem konfrontiert wird. Peroutka beschreibt diese Menschen nicht als Individuen, weil jede Individualität verlorengeht. Wie ein Stück Fleisch in einer Salzsäure sich langsam auflöst, wird die Individualität der Menschen im Lager oder im Gefängnis so lange verdünnt, bis nur noch Reflexe des Überlebens übrigbleiben.
Ferdinand Peroutka schildert diese Höllenfahrten in einer Sprache, die zunächst ohne Empathie auszukommen scheint. Wie unter einer Glasscheibe betrachtet der Autor die Verhaltensweisen seiner Protagonisten, und gerade deshalb fängt er eine menschliche Existenz ein, die einem den Atem verschlägt.
Vielleicht verbirgt sich hinter einer Diskussion im Lager die Philosophie des Autors. Hier lässt er einen der Insassen, einen Professor, sagen: "Wir hassen, was uns zermalmt, es zu verabscheuen ist uns aber nicht möglich."
Der tschechische Autor Peroutka (1895 bis 1978) war eigentlich Journalist und in der Ersten Republik außerordentlich erfolgreich - als Chefredakteur der wichtigsten Kulturzeitschriften ebenso wie als Pressesprecher von Präsident Masaryk und Freund und Berater von dessen unglücklichem Nachfolger Benes. Nach der Okkupation wird Peroutka in "Schutzhaft" genommen und nach Buchenwald verschleppt. Die Anmutung seines Romans als Tatsachenbeschreibung oder Reportage hat also durchaus einen professionellen Hintergrund. Aber man legt dieses Buch nur schwer aus der Hand, so sehr zieht die unprätentiöse, aber gerade deshalb ungeheuer eindrucksvolle Sprache den Leser in ihren Bann. Gerade dieser Sprache wegen ragt der Roman aus der großen Anzahl literarischer Bewältigungsversuche über den Terror der SS hinaus. Selbst wenn Peroutka Foltermethoden schildert, hat man den Eindruck, dass er als Autor nicht Partei ergreift. Nur in ganz wenigen Passagen verlässt er diese scheinbare "Objektivität" des Berichterstatters. Etwa bei der Schilderung des Todes eines Gestapo-Offiziers, der in Prag die Frauen Inhaftierter sexuell ausnutzt, weil diese glauben, dadurch ihren Männern helfen zu können. Dieser Mann wird schließlich an die Front auf dem Balkan geschickt und dort von Partisanen bestialisch ermordet.
Aber nicht nur die Greuel im Lager Buchenwald (das natürlich so nicht genannt wird) sind Peroutkas Thema. Auch die Tschechen zu Hause werden gnadenlos geschildert. Dr. Pokorny, dessen Frau Eva sich dem Gestapo-Mann hingibt, gerät in eine Widerstandsgruppe, weil er seinem verehrten Lehrer folgt. "Sollte es nötig sein, werden wir tapfer sterben", sagt er, nicht ahnend, dass er für diese Tapferkeit nicht die Kraft haben wird. Erst als er in der Berliner Todeszelle einen Polen trifft, der für sein Land stirbt und dies aufrecht und in Würde, wird Pokorny klar, dass er eigentlich nichts hat, wofür er sterben will.
Der Bankangestellte Novotny, in dem man leicht den Autor erkennen kann, kehrt schließlich nach Prag zurück. Er besteht darauf, dies in seiner Häftlingskleidung zu tun, und er merkt bald, welche Provokation darin liegt, haben die Prager sich doch längst wieder "eingerichtet", sie möchten eigentlich nicht erinnert werden. Novotny spürt auch schon den Eishauch des neuen Totalitarismus, der sich unter der Fassade vorbereitet. Im Lager hat er erleben müssen, wie die einzige organisierte Gruppe nach der Befreiung, die Kommunisten, die Macht ergriffen und auf der Basis der erbeuteten Denunziations-Akten der SS ihre Leidensgenossen vor "Gericht" gestellt haben. Überall, ob in der Prager Bar "Bijou" oder im Lager, erklingt der Walzer-Ohrwurm "An der schönen blauen Donau" und erinnert an das verlorene, im Rückblick verklärte "schöne" Leben. Aber "die Donau war nie blau", sagt der Führer der Widerstandsbewegung, in die Pokorny eintritt, das ist eine Illusion, wie das Leben außerhalb der Hölle ein solches war.
Peroutka hat den ersten großen Roman über die Zeit der deutschen Okkupation und die Schicksale der Verschleppten und Ermordeten geschrieben. Hervorgegangen ist er aus einem Theaterstück, das 1947 in Prag aufgeführt wurde. Danach ist der Autor in die Vereinigten Staaten emigriert und hat dort maßgeblich die Gründung von "Radio Free Europe" mit beeinflusst. Die tschechische Redaktion des Senders hat er dann jahrelang geleitet. Sein Roman, der 1976 in Amerika beim tschechoslowakischen Exilverlag 68 Publishers veröffentlicht wurde, ist nun zum ersten Mal in deutscher Sprache erschienen, hervorragend übersetzt von Mira Sonnenschein. In Prag ist er seit Jahren vergriffen, der Autor als Schriftsteller nahezu vergessen.
Das Buch ist ein großartiges Beispiel nicht nur der tschechischen Literatur, so wie sie noch aus der Zeit der Ersten Republik ihre europäische Bedeutung bezogen hat. Vor allem ist es eine moralische Ehrenrettung für das Land, von dem der dem Tode geweihte Pole zu Dr. Pokorny sagt, es habe sich "daran gewöhnt, sich klein zu machen". Kein Wunder, dass eine unantastbare moralische Autorität, Václav Havel, das Buch für einen "der besten tschechischen Romane" gehalten hat.
HANS-PETER RIESE
Ferdinand Peroutka: "Wolke und Walzer". Roman.
Aus dem Tschechischen und mit einem Nachwort von Mira Sonnenschein. Elfenbein Verlag, Berlin 2015. 376 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main