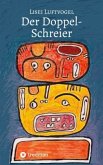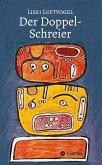So wie für Lawrence Durrell das alte Alexandria die Hauptstadt der Erinnerung war, ist für Elias Khoury das wiederaufgebaute Beirut die Hauptstadt der Amnesie. Yalo, der aus einer christlich-syrianischen Familie stammt, wächst in Beirut auf. Jung gerät er in eine der Milizen des Krieges. Nach dessen Ende wird er Wächter eines Waffenhändlers. In den Hügeln außerhalb Beiruts überfällt er nächtens Liebespaare, raubt und vergewaltigt - und verliebt sich in eines seiner Opfer, Shirin. Sie zeigt ihn an. Er wird festgenommen und gefoltert. Man zwingt ihn, sein Leben aufzuschreiben, immer neu, denn nie sind die Folterer zufrieden - selbst wenn er zugibt und ausmalt, was er gar nicht getan hat. So gerät Yalo außer sich. Im Schmerz trennt er sich von seinem Körper und erfindet sich im Geist. Mit jeder neuen Fassung verändert sich die Beschreibung, sie reichert sich an, sie franst aus, verschmutzt, färbt sich, oszilliert, sie nimmt ein Sprach- und Eigenleben an: Yalo - ein libanesisches Leben in Zeiten des Kriegs und Nachkriegs. Elias Khourys sprachmächtiger Roman erzeugt - mitreißend und erkenntnisstiftend zugleich - einen Taumel.

In seinem Roman "Yalo" erzählt der libanesische Autor Elias Khoury ergreifend von einem jungen Araber, der zum Krieger wird
Natürlich, als der Krieg ausbrach, hätte er gehen können. Nur war der Großvater dagegen, und der hatte seine Gründe. Das Exil sei nichts, erklärte er dem Enkel. Es führe den Menschen in die Irre, lasse ihn verkümmern und am Ende sogar sterben. Und da der Großvater weiß, wovon er spricht, nimmt sich der Enkel den Rat zu Herzen und bleibt.
Es dauert nicht mehr lange, und er findet sich an einer der Fronten wieder, als Kämpfer der maronitischen Falange-Miliz, die sich im Frühjahr 1975 immer weitere Scharmützel mit der in Beirut ansässigen PLO, der Palästinensischen Befreiungsorganisation, liefert. Kleinere Gefechte zunächst nur, die dann aber den ganzen Libanon in Brand setzen. Fünfzehn Jahre stehen Christen und Muslime, Rechte und Linke, Libanesen, Israelis und Syrer einander gegenüber, in flirrenden Koalitionen und Konstellationen, in Häuserkampf und Bombenhagel, inmitten einer gespenstisch zerrissenen Stadtlandschaft mit stets neu sich formierendem Frontverlauf.
Und mittendrin kämpft er: Yalo, der Erzähler aus dem gleichnamigen Roman des libanesischen Schriftstellers Elias Khoury. Darin zeichnet er das Porträt eines Menschen, der das Pech hatte, am falschen Ort und zur falschen Zeit zur Welt gekommen zu sein. Er ist vierzehn Jahre alt, als die Libanesen sich in das jahrelange Gemetzel stürzen, und nicht viel älter wird er sein, als er dann selbst zur Waffe greift. Aus Überzeugung? Nein. Sondern weil ein Truppenführer ihn auffordert, ein "Bock" zu werden, wie die jungen Kämpfer in jener Zeit genannt werden. Gewollt hatte Yalo ursprünglich etwas anderes. Denn eigentlich ist er Kalligraph.
Allerdings legt es Khoury nicht darauf an, seiner Geschichte eine larmoyante Wendung zu geben. Denn Yalo mag zwar ein Opfer sein. Er wird aber auch zum Täter. Im Krieg hat er Menschen getötet. Gut möglich, dass sich das nicht verhindern ließ. Schuldig wurde er indessen, weil er sich der Gewalt auch nach dem Bürgerkrieg noch verschrieb. Darum sitzt er nun, der Roman spielt wesentlich im Jahr 1992, in U-Haft, oder besser, in dem, was die Verantwortlichen in den Nachwirren des Bürgerkriegs darunter verstehen: in einer unterirdischen Zelle mit direkter Anbindung an einen Folterraum. Da sie den Erklärungen des Angeklagten nicht trauen, machen die Ermittler von den dort verfügbaren Instrumenten ausgiebig Gebrauch.
So muss Yalo seine Geschichte wieder und wieder aufschreiben, in stets neuen Varianten, von denen seine Peiniger sich neue Erkenntnisse erhoffen. Aber Yalo sperrt sich, der alten Kriegsregel folgend, dass jede dem Feind zugängliche Information die eigene Position gefährdet. Doch angesichts der drohenden Qualen kann er nicht anders, als sein Leben niederzuschreiben - ohne aber darauf zu verzichten, Schutz noch in den Geständnissen selbst zu suchen: "Tinte war die einzige Waffe, mit der er seine Jäger in die Irre führen und sich vor dem Tod retten konnte."
Aufzeichnungen, die ihm die Ermittler nicht abnehmen, darum neue Erklärungen anordnen, denen sie genau so wenig trauen: Diese nicht abreißende Text-Kette, eine perverse Variante von Tausendundeiner Nacht, ist es, die der Leser in den Händen hält. Und wie immer das Verhältnis von Dichtung und Wahrheit auch aussehen mag, der Text liefert das Psychogramm eines jungen Mannes, der heranwuchs in dunkler Zeit. So viel scheint klar: Aus dem Krieg hat Yalo nie wieder herausgefunden. Gegen Ende der Kämpfe plündert er mit einem Freund die Kasse einer Kaserne und flüchtet nach Paris. Dort aber setzt sich der Freund samt Beute ab. Yalo landet auf der Straße und lernt einen windigen libanesischen Geschäftsmann kennen, dem er, zurück in Beirut, als Bodyguard dient. In dieser Funktion gewöhnt er sich an, in Autos flirtende Liebespärchen zu überfallen. Die Männer raubt er aus, die Frauen vergewaltigt er.
Yalos Auslassungen sind ein einziger Versuch, die Vorwürfe zu widerlegen und nicht mehr Abzustreitendes zu erklären: "Mir wurde klar, dass der alte Yalo sich seines Tuns nicht bewusst gewesen ist. Das heißt, dass er sein Leben nicht selbstbestimmt geführt hat. Denn er war wie hypnotisiert." Das klingt wie aus einem Lehrbuch der Gerichtspsychologie. Das Problem ist nur, dass es darum nicht weniger wahr ist, zumindest nicht weniger denkbar. Yalo, der Mann mit kurdischen ebenso wie syroaramäischen Wurzeln, der Christ in muslimisch dominierter, zu Beginn des Kriegs als feindlich gedeuteter islamischer Umgebung: Er ist der ideale Kandidat für alle Militärführer, die frischen Nachschub an der Front suchen. Ohne es selbst zu bemerken, wird er zum Handlanger des Todes, übernimmt ein Werk, das stärker ist als er selbst, ihn darum dauerhaft in Beschlag nimmt.
All dies klingt nach Klischee. Aber nichts spricht dagegen, dass bisweilen auch Klischees Handlungsmacht entfalten können. Natürlich, die ganze Wahrheit erfährt der Leser bis zum Schluss nicht, und dank seiner raffinierten Erzähltechnik weckt Khoury zuletzt auch Zweifel am Urteil, das das Gericht über diesen Sünder ohne Willen ergehen lässt. Am Ende dieses von Leila Chamaa brillant ins Deutsche übertragenen Romans weiß man zweifelsfrei nur eines: "Yalos Geschichte, mein Herr, heißt Krieg."
KERSTEN KNIPP
Elias Khoury: "Yalo". Roman.
Aus dem Arabischen von Leila Chamaa. Suhrkamp Verlag, Berlin 2011. 378 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Ein reines Vergnügen war die Lektüre dieses Romans von Elias Khoury nicht für den Rezensenten Kersten Knipp, denn sie führte ihn zurück in die grauenvolle Zeit des libanesischen Bürgerkriegs, in dem sich fünfzehn Jahre lang, Christen und Muslime, PLO und Falange, Syrer und Israelis so erbittert wie aussichtslos bekämpften. Mittendrin der Junge Yalo, den Khoury zum Kämpfer ohne Grund und ohne Willen werden lässt und der auch nach Ende des Krieges nicht aus seiner Krigerhaut kann. Wie Knipp berichtet, sitzt dieser Yalo nun im Gefängnis und rückt in Verhören und unter Folter nicht raus mit seiner wahren Geschichte, erfindet immer wieder neue Versionen und schreibt sie sich selbst wie auch den anderen schön. Das kann den Leser ganz schön strapazieren, warnt Knipp und erkennt in Yalos Geschichte die Geschichte des Krieges.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Elias Khoury erzählt in seinem faszinierenden Roman davon, was Yalo zu dem gemacht hat, was er ist.« Fokke Joel ZEIT ONLINE 20110614