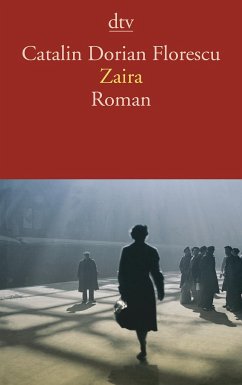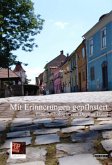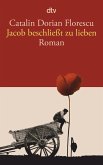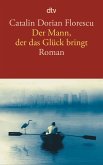Die kühne Lebensreise einer ungewöhnlichen Frau
Nach Jahrzehnten im amerikanischen Exil kehrt die Puppenspielerin Zaira nach Bukarest zurück und lässt ihre schwindelerregende Lebensreise Revue passieren: die Kindheitsidylle auf dem großelterlichen Landgut, die Schrecken der Kriegsjahre, die abenteuerliche Flucht in den Westen, ihre Begabung als Marionettenspielerin - und ihre große Liebe zu Traian. Ihn hatte sie einst verlassen, aber nie vergessen. Nun will sie ihn wiedersehen.
Nach Jahrzehnten im amerikanischen Exil kehrt die Puppenspielerin Zaira nach Bukarest zurück und lässt ihre schwindelerregende Lebensreise Revue passieren: die Kindheitsidylle auf dem großelterlichen Landgut, die Schrecken der Kriegsjahre, die abenteuerliche Flucht in den Westen, ihre Begabung als Marionettenspielerin - und ihre große Liebe zu Traian. Ihn hatte sie einst verlassen, aber nie vergessen. Nun will sie ihn wiedersehen.

Das Übertreiben gehört zu seinen ersten Landsleuten: Catalin Dorian Florescu schreibt eine rumänische Sippengeschichte voller Flunkereien.
An Familien- und Lebensgeschichten, mit denen das zwanzigste Jahrhundert durchmessen wird, herrscht in der deutschsprachigen Literatur unserer Tage kein Mangel. Der Roman "Zaira" bietet die rumänische Perspektive. Catalin Dorian Florescu, Jahrgang 1967, deutsch schreibender Schweizer Schriftsteller rumänischer Herkunft, stellt seine Titelheldin gleich zu Beginn ganz in die Tradition unzuverlässiger Ich-Erzähler, wenn sie sich nicht nur an ihre eigene Geburt erinnern kann, sondern auch damals bereits verstanden haben will, was in ihrer Umgebung geredet wurde. Zaira kommt 1998, als Siebzigjährige, wieder in ihre rumänische Heimat, nachdem sie drei Jahrzehnte in Washington gelebt hat und längst amerikanische Staatsbürgerin geworden ist. Rückblickend erzählt sie ihr Leben. "Das Übertreiben gehört zu meinen ersten Landsleuten", stellt sie fest; und in diesem Sinne ist sie ganz Rumänin geblieben.
So erfahren wir beispielsweise, dass sie, als sie als junge Frau bei einer Schauspielschule in Bukarest vorspricht, von den Theaterleuten gleich mit der größten Schauspielerin des Landes verglichen wird. Das Schauspielstudium nimmt sie dann gar nicht auf; vielmehr wird sie Puppenspielerin in Timisoara. Sowohl bei der Aufnahmeprüfung als auch mit den Marionetten improvisiert sie Szenen, in denen sie sich als kleines Mädchen mit den Figuren der Commedia dell'Arte zusammenführt. Denn solche Szenen hatte ihr zwanzig Jahre älterer Cousin Zizi ihr in ihrer Kindheit vorgespielt. Die Kindheitsmythen und -muster bleiben ihr Leben lang Zairas Bezugspunkte, an denen sie alles misst. Der Autor ist studierter Psychologe.
Zairas Kindheit spielt sich auf einem Landgut in der rumänischen Provinz, im Dorf Strehaia, in der Gutsbesitzerfamilie ab. Mutter und Vater bekommt sie nur selten zu Gesicht. Der Vater ist Kavallerieoffizier, die Mutter hält es auf dem Lande nicht aus; sie zieht es nach Paris, mindestens aber nach Bukarest. Zaira wächst unter der Obhut der Großmutter und der Tante, vor allem aber des von ihr vergötterten Zizi auf. Die Familie heißt Izvoreanu; der Name fällt aber erst auf Seite 116, denn hier ist der Roman am Ende des Zweiten Weltkriegs und bei der Machtübernahme der Kommunisten angekommen. Nun ist es vorbei mit "gnädiger Herr", "gnädige Frau" und "gnädiges Fräulein".
Die Irrungen und Wirrungen des zwanzigsten Jahrhunderts prägen naturgemäß das Leben dieser Familie. So überlebt der Vater Stalingrad, wo rumänische Soldaten an der Seite der Deutschen gekämpft haben. Die egozentrische Mutter hat in Bukarest einen jüdischen Liebhaber, den sie unter Zwang verleugnet. Als aber im Krieg ein Deportationszug mit Menschen in Viehwaggons auf dem Dorfbahnhof hält, lässt sie sich nicht davon abhalten, zu den Wagen zu laufen, um nach ihm zu fragen, wendet sich jedoch desinteressiert ab, als man ihr sagt: "Das sind keine Juden, gnädige Frau, das sind Zigeuner."
In Zairas Sicht haben die Auswirkungen der "großen" Geschichte auf ihr Leben immer auch in den kleinen Geschichten ihrer persönlichen Erfahrungswelt, vor allem ihrer Kindheit, ihre Ursache: Wird die Familie unter den Kommunisten drangsaliert, so steckt dahinter Dumitru, ein Bauernsohn aus Strehaia, der den ehemaligen Gutsherren die Schuld am Unfalltod seines Vaters gibt. Geschieht ihnen nichts Schlimmeres, so liegt dies am Schutz durch den ehemaligen Liebhaber der Mutter, der, nachdem er durch Flucht in die Sowjetunion überlebt hat, nach dem Krieg ebenfalls Karriere in der Kommunistischen Partei macht.
Zairas weiterer Lebensweg beschert ihr unter anderem zwei Ehen, dazwischen die komplizierte Liebe zu einem Puppenspielerkollegen, den sie endgültig verlässt, als sie von ihm schwanger wird, eine schwierige Beziehung zu ihrer Tochter, 1968 die Flucht nach Österreich über die Tschechoslowakei (just als dort, ohne rumänische Beteiligung, die Truppen des Warschauer Pakts einmarschieren), schließlich ein Immigrantenleben in Amerika. Wer immer Zaira über den Weg läuft, berichtet ihr seine Lebensgeschichte. Das alles wird ausladend und sprachlich solide erzählt, wirkt aber doch zunehmend ermüdend, zumal im letzten Teil, der in der amerikanischen Hauptstadt spielt. Hier gelingt Florescu das Verweben der episodisch auftretenden Personen mit Zairas Leben weniger überzeugend als zuvor. Es mag ja ein Klischee sein, von einem fast 500 Seiten umfassenden Roman zu sagen, kürzer wäre er besser geworden; aber hier trifft es ganz gewiss zu.
Zum Schluss muss Zaira erkennen, dass sie lange blind für manches gewesen ist, was vor ihren Augen ablief. Strehaia hat als Deutungsmuster der Welt eben doch nur bedingt getaugt, scheint sich aber ganz am Ende, wieder in Rumänien, nochmals in grotesker Weise in dieser Hinsicht zu bestätigen. So wird zuletzt noch einmal deutlich, dass dies, bei allen historischen Bezügen, keineswegs ein realistischer Roman ist. Er tarnt sich nur über weite Strecken als ein solcher.
HARDY REICH
Catalin Dorian Florescu: "Zaira". Roman. Verlag
C. H. Beck, München 2008. 479 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Durchwachsen findet Rezensentin Beatrix Langner diesen Roman über ein rumänisches Emigrantenleben aus den 1960er Jahren, die Catalin Dorian Florescu vorgelegt hat. Das Buch scheint ihr "halb Roman, halb Lebensbericht". Sie vermutet, dass der Autor auf eine autobiografische Vorlage zurückgegriffen hat und sich damit einer "Wirklichkeit aus zweiter Hand" bedient. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Das Problem im vorliegenden Fall ist für Langner aber, dass der Autor dem Leben seiner bewunderten Romanheldin Zaira, die 1968 aus Rumänien flieht und in den USA ein Nobelrestaurant leitet, erzählerisch nicht wirklich gewachsen ist. Zaira wirkt auf Langner doch oft wie eine "Puppe ihres Autors". Sie hält ihm vor, diese Figur nicht "von innen heraus" entwickelt zu haben. Zudem kritisiert sie die immer wieder "plakativen Bilder", die Florescu verwendet. Auf der anderen Seite hebt sie bei aller Kritik hervor, der Roman breite durchaus mit Charme, Witz und Poesie ein "aufregendes, reiches, mutiges Leben zwischen den Diktaturen, Ländern, Kontinenten und Systemen" vor dem Leser aus.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH